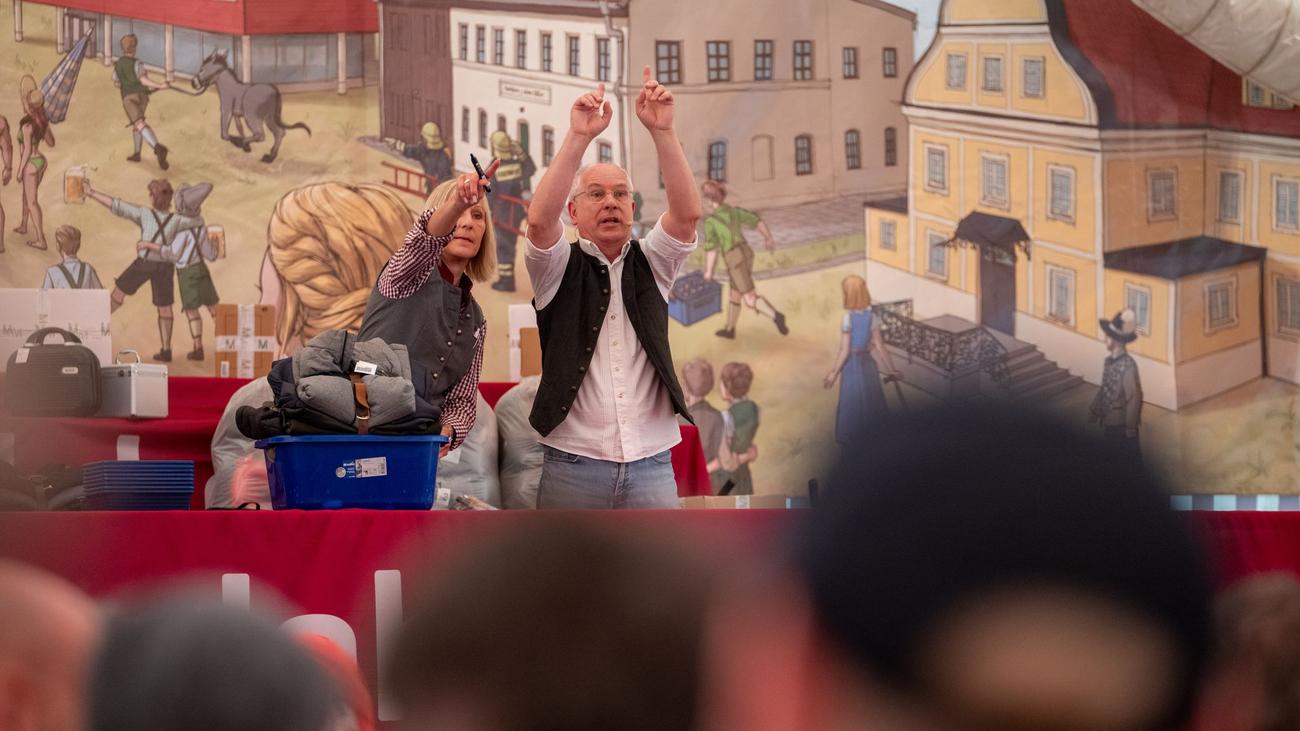Misha Glenny: "Das sind extrem ehrgeizige Kerle"

DIE ZEIT: Wo begegnet einem in einer hübschen Stadt wie Wien das organisierte Verbrechen? Misha Glenny: Wien ist ein interessanter Ort. Auf den ersten Blick wirkt alles bestens geordnet, die Fassaden glänzen. Aber das trügt. Tatsächlich ist Wien ein Hort der Korruption. Kriminelle aus Russland, aus der Ukraine, aus Kolumbien, den USA und vielen andern Staaten waschen hier ihr Geld. Das gilt auch für London oder Frankfurt. Finanztransaktionen sind ein zentraler Bestandteil des organisierten Verbrechens. Sie finden im Verborgenen statt. Warten Sie, ich zeige Ihnen etwas. Misha Glenny klappt seinen Laptop auf. Er zeigt einen Ausschnitt aus "McMafia", einer BBC-Serie über das organisierte Verbrechen, die auf seinen Recherchen beruht. Man sieht einen Banker, der in der Londoner City vor seinem Rechner sitzt. Per Mausklick gibt er den Befehl für eine Transaktion. Es folgt ein Stakkato aus hart geschnittenen Szenen: Das Büro einer Offshorefirma auf den Cayman Islands. Ein Bankschalter in Dubai. Schließlich der Hafen von Mumbai, wo ein Zöllner einen Umschlag mit Geld entgegennimmt. Es stellt sich heraus: Der Banker hat eine Zahlung angewiesen, mit der ein berüchtigter Menschenhändler die Hafenbeamten in Mumbai schmiert. Glenny: Ist das nicht Wahnsinn? Man kann mit einem Mausklick weltweit eine Kaskade von Verbrechen in Gang setzen. Das Problem ist: Es ist verdammt kompliziert, jemandem diesen einen Mausklick nachzuweisen. Die Serie kam 2018 heraus, zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Panama Papers. Sie hat damals eine Debatte darüber angestoßen, woher die Vermögen der Londoner Superreichen eigentlich stammen. Für die Strafverfolgungsbehörden gab es kaum Wege, das herauszufinden. Gemeinsam mit Finanzexperten und NGOs wie Transparency International habe ich für eine Gesetzesänderung geworben. Nach langem Ringen und dank einiger sehr engagierter Abgeordneter wurde dann in London ein Gesetz verabschiedet, das sogenannte McMafia-Gesetz. ZEIT: Hat es etwas gebracht? Glenny: Das Gesetz an sich war schon ein Erfolg, aber die Wahrheit ist: Es ist immer noch wahnsinnig schwer, Geldwäschern auf die Spur zu kommen. Die erste Person, die auf Grundlage des McMafia-Gesetzes gezwungen wurde, die Herkunft ihres Vermögens offenzulegen, war die Ex-Frau des ehemaligen Chefs der Zentralbank von Aserbaidschan, eines Betrügers, der in seiner Heimat im Gefängnis saß. Die Ex-Frau lebte in London in einem Haus, das 18 Millionen Euro wert war. Sie besaß einen Golfplatz und weitere Immobilien. Sie ging im Luxuskaufhaus Harrods shoppen. Mittlerweile weiß man, dass sie dort in zehn Jahren umgerechnet 19 Millionen Euro ausgegeben hat. Die Ermittler fanden heraus, dass der Reichtum dieser Frau sich aus den betrügerischen Geschäften ihres Ex-Mannes speiste, ein großer Teil ihres Vermögens wurde konfisziert. ZEIT: Das klingt nach einem Ermittlungserfolg. Glenny: Ja, aber der Aufwand war unverhältnismäßig. Sechs Jahre lang wurde gegen diese Frau ermittelt, unzählige Beamte waren involviert. Und dabei war sie nicht einmal ein dicker Fisch. Gegen Finanzkriminalität zu ermitteln, erfordert so viel Expertise. Für einfache Polizeibeamte, die meist in unterfinanzierten Behörden sitzen, ist es immer noch fast unmöglich, dagegen vorzugehen. ZEIT: Herr Glenny, Sie haben die halbe Welt bereist, um Mafiaclans und Drogenbosse zu erforschen, in Südamerika, auf dem Balkan, in Russland. Was sind das für Menschen, die sich der organisierten Kriminalität anschließen? Glenny: Das sind oft zwielichtige, extrem ehrgeizige Kerle. Sie betrachten die Welt als brutalen Ort und haben ein exzellentes Gespür dafür, wie sich in einer solchen Welt Geschäfte machen lassen. Sie ticken im Grunde wie Entrepreneure. In Brasilien habe ich einen Mann getroffen, den Boss eines Kokainkartells, der jahrelang der meistgesuchte Verbrecher des Landes war. Ich habe ihn im Gefängnis besucht. Er hat mir von der Favela erzählt, in der er aufgewachsen ist, von seiner Familie. Er war Zeitungsausträger – bis er in den Drogenhandel einstieg und zu einem der einflussreichsten Männer Brasiliens wurde. Hätte er als Kind dieselben Chancen gehabt wie ein Junge aus der Mittel- oder Oberschicht, wäre er vermutlich ein erfolgreicher Unternehmer geworden. ZEIT: Das heißt, er war kein böser Mensch? Glenny: Definitiv nicht. Viele Verbrecher, die ich getroffen habe, kommen aus ähnlichen Verhältnissen, werden nicht als Kriminelle geboren. Sie realisieren, wie begrenzt ihre Möglichkeiten in der legalen Sphäre sind, und schließen sich der organisierten Kriminalität an. Was nicht heißt, dass es nicht wirklich düstere Gestalten gibt. © Lea Dohle Newsletter ZEIT-Verbrechen-Newsletter Alle zwei Wochen exklusive Akteneinsicht zum Podcast, Hintergrundgeschichten und Neuigkeiten aus der Redaktion im ZEIT-Verbrechen-Newsletter. Abonnieren ZEIT: In einem Ihrer Bücher schreiben Sie über einen Auftragskiller, den Sie in Indien getroffen haben. Warum redet so jemand mit Ihnen? Glenny: Der Auftragskiller war am Ende seiner Karriere. Er wollte jemandem seine Geschichte erzählen. Ich nehme mir für meine Gespräche viel Zeit, ich frage nicht einfach drauflos: Okay, Sie sind ein Killer, was genau haben Sie gemacht? In den ersten Stunden befrage ich die Verbrecher zu ihrem Leben: Wo wurden Sie geboren? Was haben Ihre Eltern gemacht? Wie sind Sie aufgewachsen? Es gibt nichts, was Menschen mehr genießen, als über sich selbst zu erzählen. Von ihren Verbrechen berichten diese Leute dann von selbst. Ich höre nur zu und versuche, nichts zu bewerten.