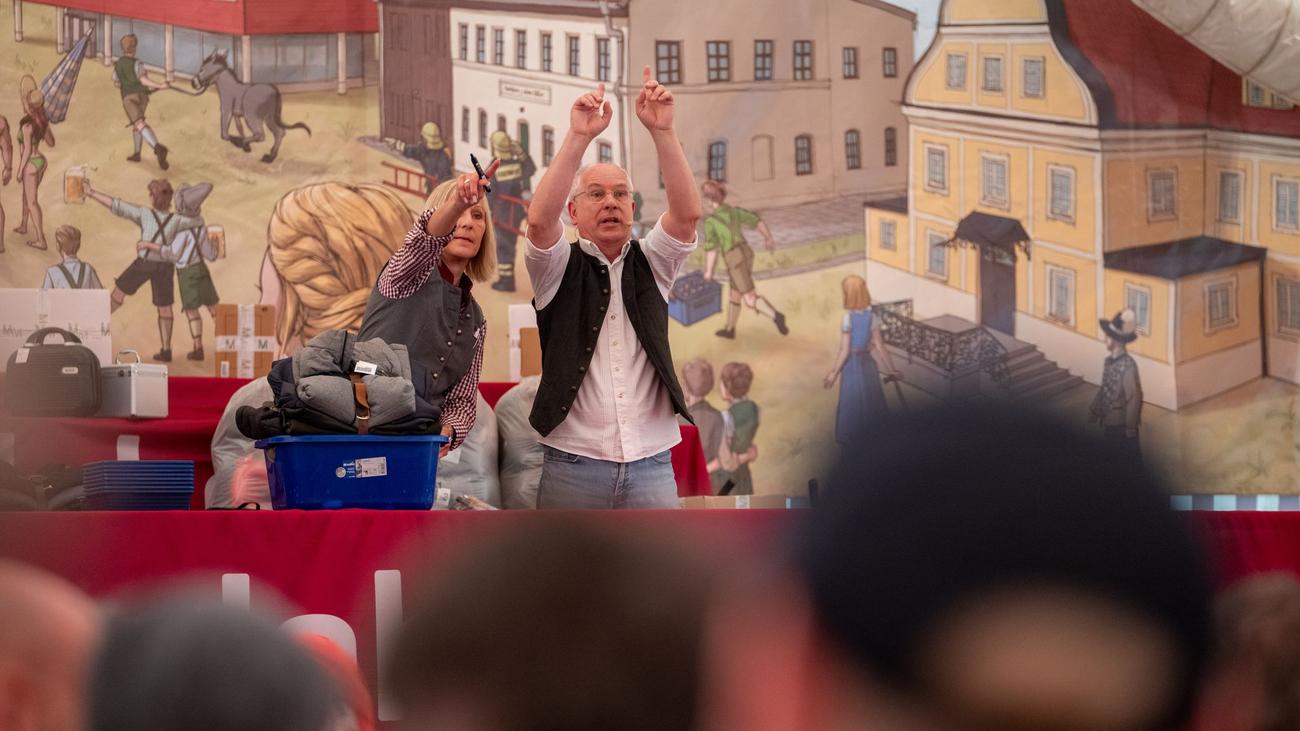Freitag: "Digital Native" als Altersangabe, Details zu NSO-Spyware bei WhatsApp

Eine Stellenanzeige warb um "Digital Natives". Ein qualifizierter "Digital Immigrant" bewarb sich erfolglos. Der Nicht-Arbeitgeber muss ihn entschädigen, wie ein Arbeitsgericht jetzt urteilt. Denn nach allgemeiner Definition sind "Digital Native" jüngere Menschen, sodass diese Ausschreibung eine Altersdiskriminierung darstellt. In einem anderen Verfahren geht es um Spyware bei WhatsApp. Hier verrät ein Gerichtsdokument Standorte der Opfer, für die Angriffe genutzte Server und die Herkunft der Angriffe. Innerhalb von nur rund zwei Monaten wurden 1223 Nutzer in 56 Ländern ausspioniert, wobei die meisten Opfer in Mexiko lokalisiert wurden. Derweil haben Forscher eine Alternative zum Plastikmüll präsentiert, der die Meere stark belastet. Schließlich gelangen Mikroplastikpartikel über die Nahrungskette auch wieder zum Menschen. Doch jetzt hat ein Team aus Japan einen Kunststoff entwickelt, der sich in Salzwasser komplett auflöst – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick. Anzeige "Digital Native gesucht" mag bei der Partnersuche zulässig ein, doch bei der Suche nach Mitarbeitern kann das teuer kommen. Denn diese Formulierung kann verbotene Diskriminierung älterer Bewerber darstellen. Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg hat dies jetzt in einem Berufungsverfahren bestätigt. Demnach beschreibt der Begriff "Digital Natives" jene Generation von Menschen, die mit digitaler Technik "wie Computern, dem Internet und anderen mobilen Geräten aufgewachsen sind". "Digital Immigrants" bezeichnen dagegen ältere Generationen, die nicht damit aufgewachsen sind. Damit habe eine entsprechende Stellenausschreibung junge Mitarbeiter gesucht und ältere Bewerber ausgeschlossen: Stellenanzeige für "Digital Native" ist Altersdiskriminierung. Ein ganz anderes Klageverfahren, nämlich der Facebook-Mutter Meta Platforms gegen die israelische Spyware-Firma NSO Group, hat bislang selten bekannte Details zu Überwachungsangriffen auf WhatsApp-Nutzer hervorgebracht. Demnach wurden in nur zwei Monaten 1223 Anwender in 51 verschiedenen Ländern angegriffen. Das kürzlich freigegebene Gerichtsdokument nennt sogar die einzelnen Länder, in denen sich die Opfer aufgehalten haben, sowie die Standorte der Angreifer und der für die Angriffe genutzten Server. Demnach wurden die meisten Opfer in Mexiko verortet, viele in Indien und Bahrein, aber auch einige in Westeuropa. Die Angriffe kamen dabei aber nicht immer aus dem gleichen Land: Gericht nennt Details zu Angriffen auf 1223 WhatsApp-User mit Pegasus-Spyware. Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmung wird hier eine externe Umfrage (Opinary GmbH) geladen. Umfragen immer laden Umfrage jetzt laden Plastikmüll ist überall auf dem Planeten zu finden. Auch die Meere sind stark damit belastet. Mit der Zeit zersetzen sich Tüten, Flaschen oder Fischernetze im Wasser. Übrig bleiben Mikroplastikpartikel, die beispielsweise in den Körper von Meeresbewohnern gelangen und diese schädigen. Über die Nahrungskette landen sie schließlich auch im menschlichen Körper. Japanische Forscher wollen Abhilfe schaffen: Sie haben einen Kunststoff entwickelt, der sich in Salzwasser auflöst. Zunächst gab es Probleme mit der Haltbarkeit, aber auch bei unbeabsichtigtem Kontakt mit Salzwasser. Doch auch dafür haben die Wissenschaftler Lösungen gefunden: Neuer Kunststoff aus Japan löst sich in Salzwasser auf. Es war eine Art kapitalistische Luftbrücke: Vor der Einführung neuer US-Zölle auf Waren aus aller Welt – die mittlerweile teilweise wieder zurückgenommen wurden – hat Apple versucht, möglichst viele Geräte in die USA einzufliegen. Mittlerweile werden weitere Details zu der Aktion bekannt. Allein aus Indien, wo der Zoll anfangs "nur" 26 Prozent betragen sollte, sollen laut Berichten 600 Tonnen iPhones importiert worden sein. Es habe sich um mindestens 1,5 Millionen Smartphone-Einheiten gehandelt. Zuvor hatte Apple die Produktion extra intensivieren lassen, um möglichst hohe Stückzahlen aus den Fabriken zu erhalten, so der Bericht: Apple fliegt wegen US-Zöllen 600 Tonnen iPhones aus Indien ein. Praktisch gleichzeitig hat Apple seinen Kartendienst auf weitere Geräte erweitert. Einst war es nur möglich, Apple Maps per App zu nutzen – und die gab und gibt es nur für macOS, iOS und iPadOS. Mittlerweile hat der iPhone-Hersteller auch eine Browser-Version bereitgestellt. Seit Sommer 2024 ist sie verfügbar: Anfangs als Beta und nur für bestimmte Browser, mittlerweile auch für Firefox und mit mehr Features, darunter der Straßenfotodienst "Umsehen". Nun beginnt Apple damit, die Web-Anwendung auch für Mobilgeräte auszurollen. Wie Apple schreibt, läuft Maps nicht mehr nur auf Mac und PC, sondern auch auf Mobilgeräten, sowohl auf iPhones als auch auf Android-Geräten: Apple Maps im Web nun auch für Mobilgeräte. Anzeige Beim Notebook-Neukauf kann man professionelle Umzugsservices beauftragen, die Daten vom alten auf das neue Gerät zu übertragen. Wenn die Daten später auf Neugeräten anderer Käufer auftauchen, hat das auch rechtliche Konsequenzen. Bei massiven Datenpannen greife die Datenschutzgrundverordnung und der darin festgeschriebene Grundsatz der Datenminimierung, erklären wir im c’t-Verbraucherschutz-Podcast. Denn darin ist festgelegt, dass ein Unternehmen nur diejenigen personenbezogenen Daten verarbeiten darf, die es für den Vorgang wirklich benötigt, und nur so lange, wie es sie wirklich braucht. Wie Betroffene einer Datenpanne zu ihrem Recht kommen und in welcher Höhe etwaige Schmerzensgelder liegen, besprechen wir in der aktuellen Episode von "Vorsicht, Kunde!": Massive Panne beim Datenumzug. Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externer Podcast (Podigee GmbH) geladen. Podcasts immer laden Podcast jetzt laden Auch noch wichtig: (fds)