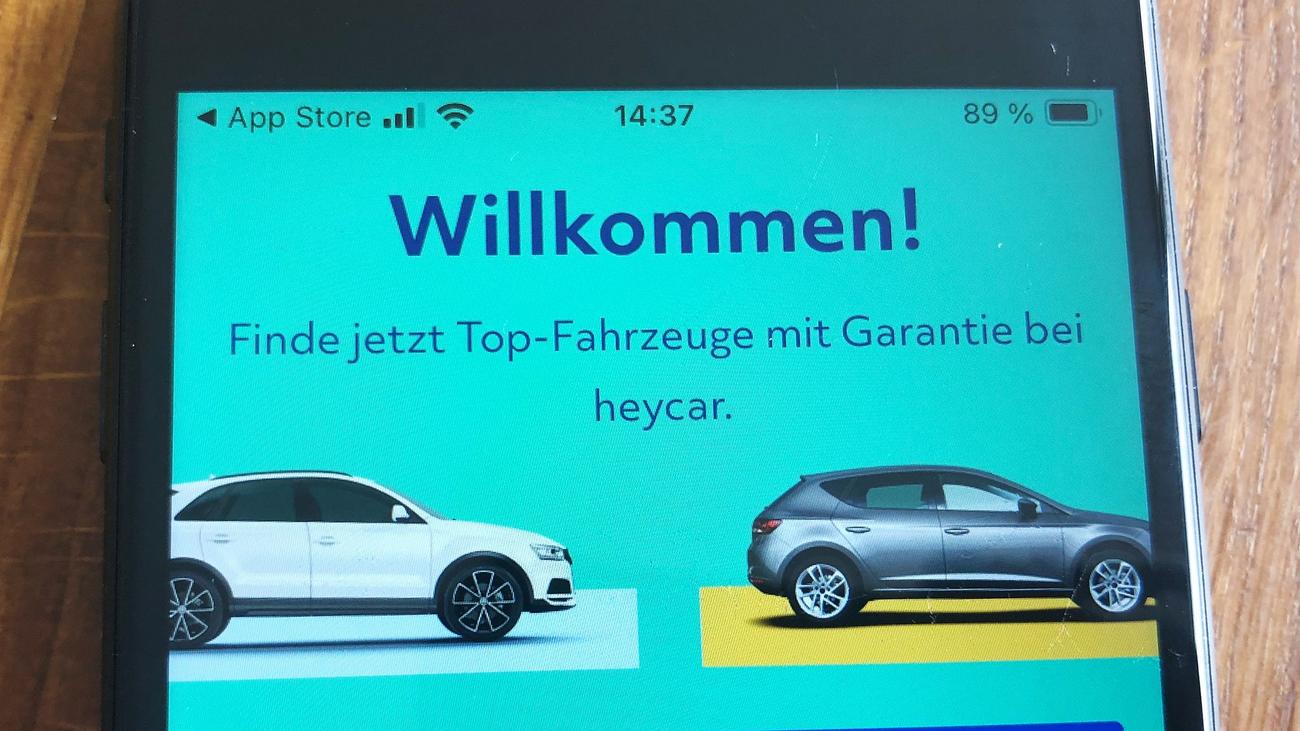Josef H. Reichholf zum achtzigsten Geburtstag

Josef H. Reichholf weiß, dass seine Thesen nicht jedem schmecken. Deswegen spricht er in seiner vor fünfzehn Jahren veröffentlichten Abhandlung über die Krise und Zukunft des Naturschutzes gleich im Vorwort eine Warnung aus. Manche Leser, heißt es da, „werden die nachfolgenden Darlegungen als Provokation empfinden“. Das sei jedoch schon in Ordnung, denn „sie sind tatsächlich als Provokation gedacht, aber im positiven Sinn“. Zum Beispiel dürften Jagdenthusiasten mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis nehmen, was der Autor über Fluktuationen und Trends im Rahmen von Populationsdynamiken zu sagen hat. Denn am Ende der Argumentation steht die Erkenntnis, dass bestimmte Tierarten ihre Bestände hochgradig produktiv halten, wenn sie nur verbissen genug abgeschossen werden. Den Kopflosigkeiten unseres Naturschutzes – interessierte Laien etwa werden häufig aus entsprechenden Gebieten ausgesperrt, Jäger oder Fischer hingegen haben Zugang – begegnet Reichholf mit sachlichen Abwägungen und scharfem Tadel; der Schönheit von Flora und Fauna steht er dafür immer noch staunend gegenüber. Insofern sind Ethik und Ästhetik bei ihm zwei Seiten derselben Medaille. Und da man sich nur für Dinge engagiert, die man kennt, befürwortet er einen Naturschutz, der Begegnungen zwischen Mensch und Tier zulässt. Was spricht denn dagegen, mit seltenen Spezies auf Tuchfühlung zu gehen? Nichts. Hinreißend sind die Anekdoten, die Reichholf in seinen Memoiren „Mein Leben für die Natur“ (2015) erzählt. Beispielsweise über zwei tote Ziesel, die er sich Mitte der Sechzigerjahre am Neusiedler See in die Jackentasche gesteckt hatte – und die wenig später als sehr lebendige, aus dem Winterschlaf gerissene Rowdys ein Wirtshaus aufmischten. Tiere sind kleine Persönlichkeiten und keine Automaten Bis 2010 leitete Reichholf, Jahrgang 1945, die Wirbeltierabteilung der Zoologischen Staatssammlung München, er war Professor für Ökologie und Naturschutz an der Technischen Universität München und ist Autor zahlreicher Bücher, die gerade nicht als Botschaft an die Fachkollegen verfasst sind, sondern ein breites Publikum ansprechen. Gemeinsam mit Bernhard Grzimek, Horst Stern und Hubert Weinzierl gründete er in den Siebzigern die „Gruppe Ökologie“, den Vorgänger des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Zwanzig Jahre lang war er Generalsekretär der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern, was nur konsequent erscheint, wenn man in einem seiner besten Bücher, „Ornis“ (2014), dieses Bekenntnis liest: „Bei mir fing die Sucht, jedem Vogel nachschauen zu müssen, in früher Jugend an.“ Wer mit offenen Augen unterwegs ist, wird manche Einsicht Reichholfs abnicken. Dass die „Stadtnatur“ (2007) für zahlreiche Arten inzwischen ein besserer Lebensraum ist als die ausgeräumte Feldflur, ahnt jeder Berliner, der durch den Tiergarten oder über die Friedhöfe der Metropole spaziert. Überhaupt die anekdotische Evidenz: Es müssen ja gar nicht immer Zahlen und Studien sein. Angesichts der von großem Beobachtungstalent zeugenden Geschichten, die Reichholf in „Rabenschwarze Intelligenz“ (2009) über seinen Kolkraben Mao oder in „Das Leben der Eichhörnchen“ (2019) über den Siebenschläfer Schmurksi erzählt, ist man schnell geneigt, Tiere als kleine Persönlichkeiten zu betrachten.