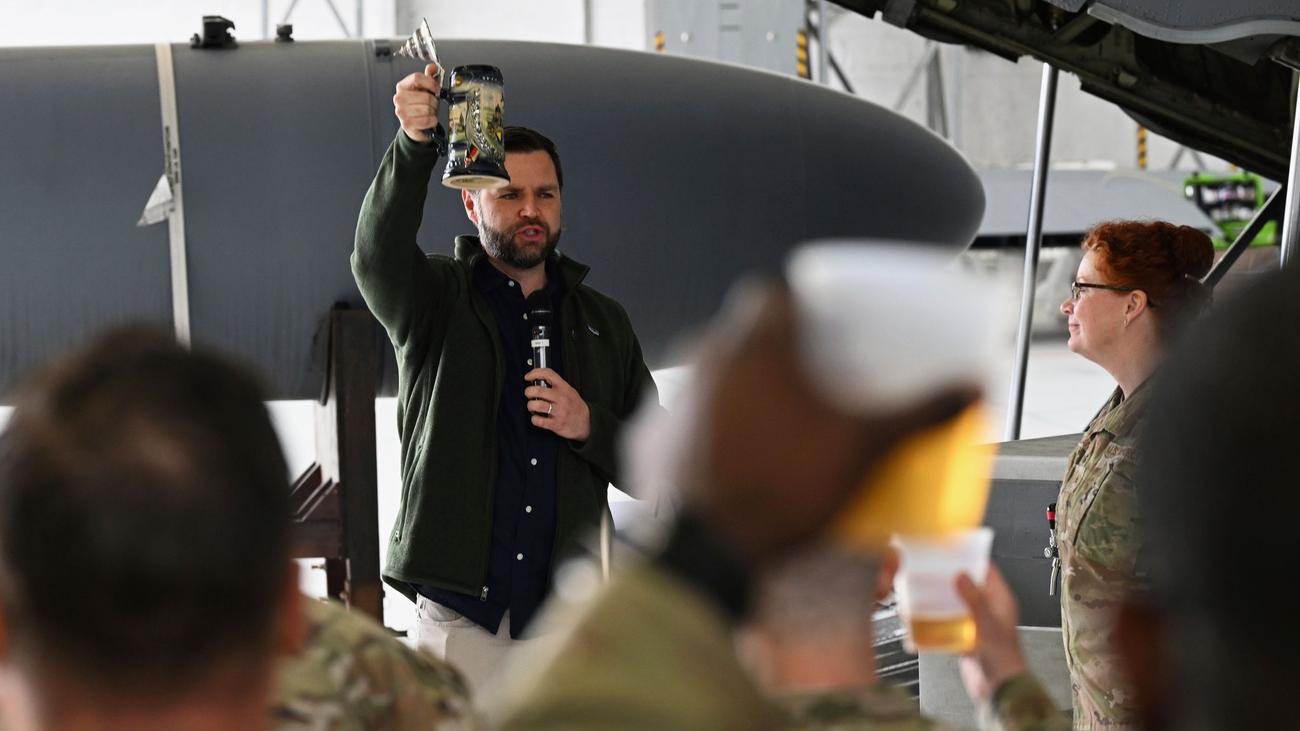Rainald Goetz: Krieg und Literatur
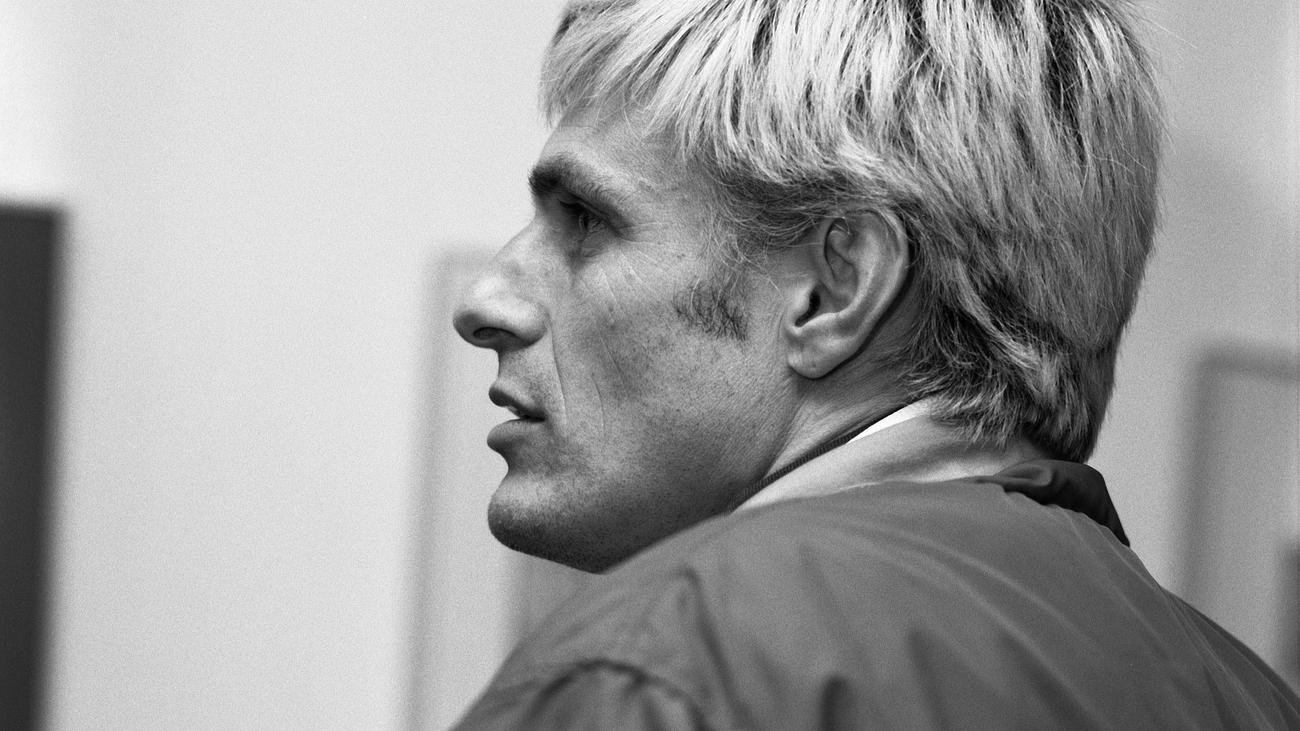
Das letzte Mal habe ich ihn in Schöneberg gesehen, in der tristen Nollendorfstraße. Es war ein Samstag, glaube ich, und er saß vor einem Eiscafé, um ihn herum zwei oder drei sehr blonde Kinder mit Eistüten. Ich grüßte ihn, er grüßte mich auch, nicht sehr freundlich, das war’s. War ich das Problem? Oder wollte er schnell wieder an den Schreibtisch zurück, statt an diesem niederschmetternd grauen Wochenende seine, wie man in Deutschland sagt, drängenden Vaterpflichten zu erfüllen? Er tat mir hinterher noch tagelang leid. Ein paar Jahre später schickte ich ihm eins meiner Theaterstücke und fragte ihn, ob er jemanden weiß, der es spielen will. Kurz darauf lag ein Brief von ihm im Postkasten, das erkannte ich sofort an seiner riesigen, fast weiblichen Schrift auf dem Kuvert. Was darin stand? Lass mich in Ruhe, schrieb er mir wütend, glaube ich, du nervst mich, wenn du im Fernsehen Bücher und Autoren zerstörst, und dein letzter Roman widert mich wegen der vielen Sexwitze an! Das Ende einer Freundschaft unter Schriftstellern, die nie eine war? München, Juni 1993. Rainald und ich sitzen auf der Treppe der Kunstakademie, sein Aufnahmegerät ist an, und wir reden fast drei Stunden darüber, warum ich ein paar Tage vorher beim Bachmannpreis in Klagenfurt als Juror untergegangen bin. Kurz davor oder danach: Rainald sagt im Schumann’s zu mir, dass er den talentierten Herrn Uslar von Tempo kennenlernen möchte, darum fahren wir zu dritt zusammen aufs Land. Auch ungefähr zur selben Zeit: Rainald macht mir in einer großen Rezension eine Liebeserklärung, die nicht nur literarisch ist, er lobt meine altmodische, undeutsche Höflichkeit und meine wahrheitsspendende Wut, womit er indirekt sagt, dass er selbst das deutsche Gegenteil von mir sei. Das ist mir unangenehm. "Rainald", sage ich, glaube ich, einmal in dieser Zeit zu ihm, "du schreibst so schön. Aber man versteht fast nie, was du sagen willst." "Was soll ich dagegen tun?", entgegnet er, in etwa, in seinem weichen Münchnerisch, "ich denke doch immer so viele Dinge gleichzeitig!" "Anfang, Mitte, Ende", sage ich. "Ja, klar, klingt einfach." "Es ist das Schwerste, was es gibt", sage ich. Kurz darauf schreibt er eine Erzählung, in der einer wie ich im New Yorker eine Erzählung veröffentlicht. Anfang: ja. Ende: ja. Und ein Deutsch, wie es kaum einer kann! Danach hat Rainald aber keine Lust mehr auf meinen jüdischen Realismuskram und verwandelt den sinnfreien Rhythmus seiner Clubnächte jahrelang in sprachliche Romantik-Exzesse, in moderne Hieroglyphen, in orange, rote und blaue Suhrkamp-Bücher. Alles kein Problem für mich. Oder doch? Ich habe Rainald immer gemocht und respektiert, auch noch, als wir beide nach Berlin umgezogen sind, wo ich ihn meistens nur noch von hinten auf seinem Fahrrad in Mitte sah. Ich mochte ihn, obwohl er viel zu empfindlich war, wie das bei aggressiven Groß-Egos wie ihm eben so ist. Es tat mir leid, dass er meine brutale Kritik an einem seiner knallroten Bücher persönlich nahm. Und ich fand es okay, dass er mich immer wieder in seinen Büchern und Artikeln wie ein betrunkener Seemann beschimpfte. Das ist Demokratie, dachte ich, das macht mir nichts, solange mich meine Gegner nicht nach Sibirien oder Xinjiang deportieren können. © ZEIT ONLINE Newsletter Natürlich intelligent Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Technologie unserer Zeit. Aber auch ein riesiger Hype. Wie man echte Durchbrüche von hohlen Versprechungen unterscheidet, lesen Sie in unserem KI-Newsletter. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Apropos Demokratie – in der Schriftsteller wie Rainald vom ersten Tag ihres Lebens an lachen, schreiben, sprechen, lesen dürfen! Weiß so einer eigentlich, wie viele ukrainische Schriftsteller seit 2022 von Russen umgebracht wurden, weil sie die Demokratie ihres Landes verteidigt haben? Schon mehr als einhundert! Als ich diese Zahl neulich in einem Interview mit Serhij Zhadan las und als der beste noch lebende zeitgenössische ukrainische Autor dann auch noch sagte, unendlich viele Texte blieben darum ungeschrieben, wurde ich plötzlich sehr wütend auf meinen alten Freund und Feind Rainald. Warum? Ganz einfach: Er hatte fast genau ein Jahr nach dem viehischen Angriff der Russen in einem Essay dem sich sammelnden Westen tatsächlich Kriegsgeilheit vorgeworfen. Und vor ein paar Wochen, zum Drei-Jahres-Jubiläum von Putins stockendem Dschingis-Kahn-Feldzug, schrieb der verträumte Rainald auf Instagram, beide Seiten verheimlichten in böser Absicht die Zahl ihrer Toten, damit keiner "faktenbasiert, anschaulich" über den Krieg nachdenken könne. Und: "Fühle immer das Gute für die, die es geschafft haben raus aus der Welt, die es schon sind, tot. Die Melancholie, die tiefe Melancholie zu leben." Pazifistischer, egoistischer, deutscher, todessehnsüchtiger, sinnloser geht es kaum, dachte ich wütend. Und plötzlich verstand ich, warum ich in Wahrheit schon immer von Rainalds diktatorischer, realitätsverneinender Romantikprosa, von seinen wolkigen Weltfluchtdialogen, von seinen wirren Rundum-Beleidigungen so abgestoßen war – und darum auch immer ein bisschen von ihm. Denn ein Schriftsteller, der nicht weiß, wie er seine Sätze und sein Material ordnen soll, weiß auch nicht, wie die Welt der Bösen und Guten funktioniert. Der spricht und schreibt die Sprache des braven Untertanen. Der ist gar kein Schriftsteller. So einfach ist das, Rainald, und so kompliziert.