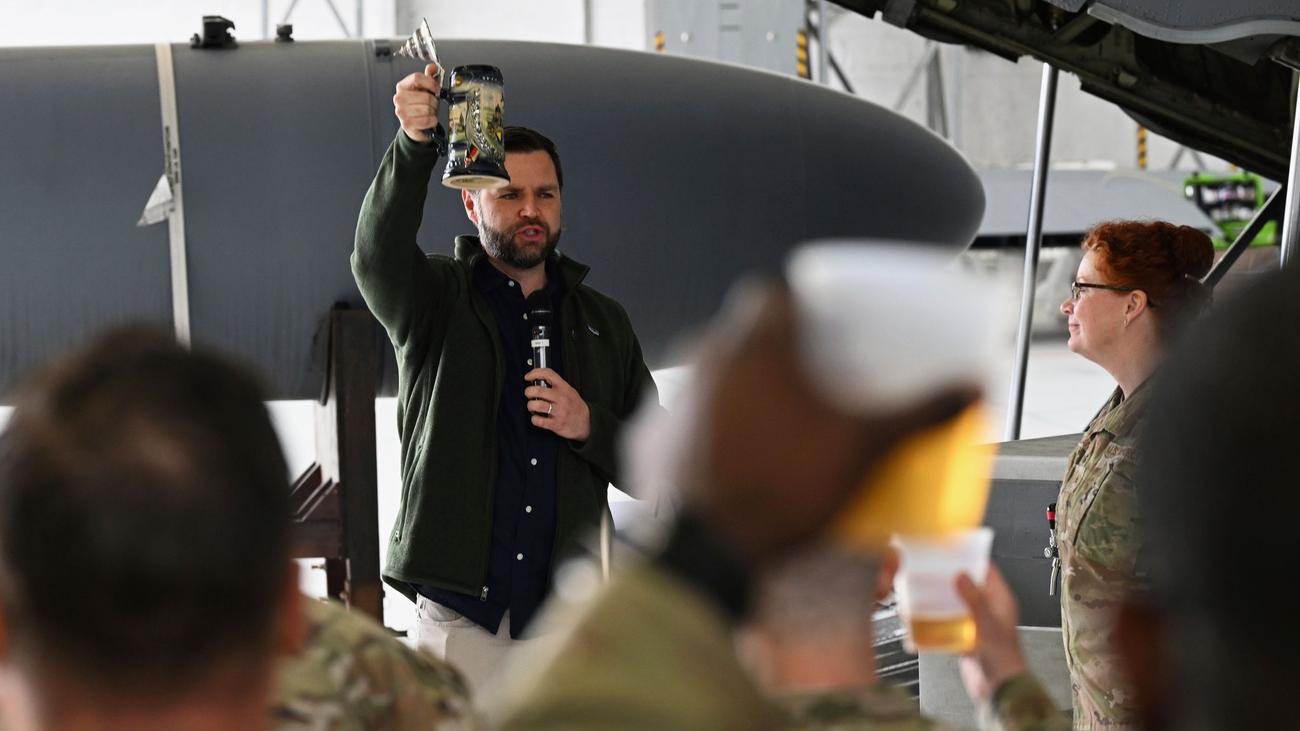Der Bürolutionär: Zum 100. Geburtstag von Heinz Nixdorf

Vor 100 Jahren wurde Heinz Nixdorf in Paderborn geboren. Mit Elektrorechnern, die das Saldieren und Kontieren der Buchhaltung erleichterten, gehörte seine Firma zu den Betrieben, die die mittlere Datentechnik etablierten. Zeitweilig hatte die Nixdorf Computer AG 250.000 Mitarbeiter und operierte in 44 Ländern. Anzeige Aufgewachsen in Armut Heinz Nixdorf erblickte am 9. April 1925 als erstes Kind von Walter Hermann und Änne Nixdorf in Paderborn das Licht der Welt. Der Vater war gelernter Bäcker, die Mutter Hausfrau. Kurz nach seiner Geburt zog die Familie nach Torgau um, wo der Vater als Handelsreisender Strickwaren verkaufte. 1929 musste die weiter gewachsene Familie nach Paderborn zurückkehren, weil ein Brand das Warenlager zerstörte. In Paderborn lebte die Familie in beengten Verhältnissen und großer Armut, bedingt durch die Weltwirtschaftskrise. Heinz Nixdorf wurde 1931 eingeschult und glänzte schon in der Volksschule mit mathematischen Kenntnissen. Trotz guter Noten reichte es nicht für den Besuch einer weiterführenden Schule, den die Familie nicht finanzieren konnte. Heinz Nixdorf um 1937 (Bild: Heinz Nixdorf Forum) Im Mai 1939 wechselte der 14-jährige Nixdorf daher in eine der neuen Lehrerbildungsanstalten, mit der das nationalsozialistische Regime den Volksschullehrermangel bekämpfte. Die zur Aufnahme erforderliche "Bewährungsprobe" der Hitlerjugend (ein Lageraufenthalt) konnte er bestehen. Seine Lehrerausbildung begann Nixdorf in Vallendar-Schönstatt, später wurde er nach Alfeld an der Leine bei Hannover verlegt, wo er nebenbei das Segelfliegen erlernte. Als Lehrgangsteilnehmer (damals Jungmann genannt) musste Nixdorf Uniform tragen und regelmäßig an Arbeitsdiensten teilnehmen. Im Mai 1942 brach Nixdorf seine Lehramtsausbildung ab und konnte schließlich nach vier Monaten das Reismann-Gymnasium in Paderborn besuchen. In der Wartezeit entwickelte er nach eigenen Angaben Logarithmentafeln und beschäftigte sich mit Fermats Theorem. Wehrdienst, Kriegsende und Studium Auf dem Gymnasium war Nixdorf Klassenprimus in Mathematik und Physik, musste es jedoch 1943 wieder verlassen, weil er zum Reichsarbeitsdienst abkommandiert wurde. Er gehörte zu einem RAD-Trupp, der nach der Möhnekatastrophe die Schäden beseitigte. Im Herbst 1943 wurde er zum Wehrdienst eingezogen und meldete sich als begeisterter Segelflieger für eine Offizierslaufbahn bei der Luftwaffe an. Rückwirkend zum 20. April 1943 (Hitlers Geburtstag) trat er in die NSDAP ein. Die Offiziers-Ausbildung war kurz, da die Luftwaffenschule bereits 1944 aufgelöst und Nixdorf zur Panzer-Division 1 Hermann Göring versetzt wurde. Das Kriegsende erlebte er mit einer Schlacht im Raum Großenhain bei Dresden. Während ein Großteil der Truppe in Kriegsgefangenschaft geriet, konnte sich Nixdorf absetzen und über die Tschechoslowakei zu Fuß nach Paderborn durchschlagen. Hier konnte er schließlich 1947 als einer der ersten Heimkehrer mit 22 Jahren das Abitur ablegen. In der Zulassung zur Abiturprüfung schrieb er: "Der Zusammenbruch Deutschlands liess in mir eine Welt der Hoffnungen und Ideale zerfallen. Was mir bisher als Höchstes galt, zeigte sich nun klein und ohne Wert. Nur langsam fand ich zu mir selbst zurück." Anzeige Mentor Walter Sprick Ab dem Wintersemester 1947/48 war Heinz Nixdorf für das Studium der Physik an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt/M immatrikuliert, mit dem Nebenfach Betriebswirtschaftslehre. Frühzeitig kam er als Werksstudent in Kontakt mit der US-Firma Remington Rand und lernte dort seinen großen Mentor Walter Sprick kennen. Dieser hatte zuvor in der NS-Zeit im KZ-Außenlager Bayreuth im "Projekt Fernsehwaffe" an einem rechnergesteuerten Zielerkennungsverfahren gearbeitet, das die "sehende Bombe" produzieren sollte. Sprick hatte in Paderborn gelebt und geheiratet und gleich nach dem Krieg in Kiel einen Rechner für die Feuerversicherung konstruiert. Bei Remington Rand leitete Sprick dann das Entwicklungslabor, in dem Nixdorf ab Dezember 1951 arbeitete. Nixdorf war damals im siebten Semester. Die beiden befreundeten sich schnell und hatten große Pläne. Nixdorfs Biograf Christian Berg schreibt: "...spätestens seit Anfang 1952 hatte er gemeinsam mit Sprick im Stillen geplant, röhrenbasierte Rechengeräte für Versicherungen und andere Großunternehmen zu entwickeln und zu vertreiben. Elektronenmultiplizierer Die ersten konkreten Überlegungen zu einer Unternehmensgründung waren dergestalt, dass sowohl Nixdorf als auch Sprick jeweils 42,5 Prozent Anteile an der zukünftigen Firma halten sollten." Den Rest sollte ein interessierter Investor bekommen, der das nötige Kapital in die Firma einbringen sollte. Aus diesen Plänen wurde nichts, denn Sprck nahm eine Anstellung bei IBM Deutschland an. Insgeheim sicherte er Nixdorf jedoch seine Mitarbeit (und die Nutzung seiner Patente) zu, was für den ersten Auftrag des Labors für Impulstechnik am 1. Juli 1952 in Essen von großer Bedeutung war. Nixdorf hatte von der RWE einen Auftrag für ein "Elektronen-Rechengerät zum Preise von ca. 25.000 DM". Zusammen mit seinem ersten Mitarbeiter Alfred Wiercioch baute Nixdorf ein Gerät, das die Lochkarten mit Fotozellen abtastete und speicherte, einen Wert berechnete und das Ergebnis druckte. Dieser Dividierer konnte 9000 Lochkarten pro Stunde verarbeiten, die Technik stammte aus dem von Sprick in Kiel gebauten Rechner. Heinz Nixdorf an seinem Arbeitsplatz im Rheinisch Westfälischen Elektrizitätswerk in Essen, 1954 (Bild: Heinz Nixdorf Forum) Während dieser Rechner verloren gegangen ist, gibt es von dem zweiten Nixdorf-Computer, einem "Elektronensaldierer", einen Nachbau, der im Heinz Nixdorf Museumsforum (HNF) in Paderborn steht. Diesem "ES 24" folgte der Elektronenmultiplizierer "EM 20". Entscheidend war, dass Nixdorf sich vom Auftraggeber RWE emanzipieren konnte und diese Lochkartensteuergeräte auch an Bull verkaufen konnte. Der französische Konkurrent von IBM in der Lochkartentechnik vertrieb die an seine Lochkartenmaschinen angepassten Geräte unter eigenem Namen. Erster Elektronen-Saldierer, 1952/53 (Bild: Heinz Nixdorf Forum) 1955 hatte Nixdorfs junge Firma bereits sieben Mitarbeiter und zog 1957 nach Paderborn. Nun war der Büromaschinenhersteller Wanderer ab 1951 Generalvertreter der Compagnie des Machines Bull und damit auch für die Auslieferung von den Zusatzgeräten in Deutschland zuständig. Voll des Lobes über die eingesetzten vier Multipliziergeräte war die Zentralverwaltung von Kaufhof in Köln, die 1960 40 Millionen Lochkarten verarbeitete. Weil in dieser Zeit bei Bull eine neue Lochkartenmaschine namens Gamma 172 auf der Basis von Transistortechnologie entstand, nahmen die Franzosen das Labor für Impulstechnik unter einen Exklusivvertrag. Fünf Jahre sollte Nixdorfs Firma ausschließlich für Bull arbeiten und außer den Wanderer-Werken mit seinen Exacta-Büromaschinen keine deutschen oder amerikanischen Konkurrenten beliefern dürfen. Somit machten sich die Paderborner daran, ihren Multiplizierer an die Exacta Multitronic 6000 anzupassen, von denen Wanderer gleich 70 Stück für 493.500 DM bestellte. Dies erwies sich als lebensrettende Maßnahme für Nixdorfs Firma, als Bull 1963 kurz vor dem Konkurs stand. Grundstein der Nixdorf Computer AG Heinz Nixdorf hatte auf einer Hannover Messe den Computerkonstrukteur Otto Müller kennengelernt. 1964 siedelte Müller, der bei IBM Research in den USA arbeitete, nach Paderborn um und wurde im Labor für Impulstechnik Chefentwickler einer volltransistorisierten, teilweise programmierbaren Fakturiermaschine, die 1965 unter dem Namen Wanderer Logatronic bzw. Praetor auf den Markt kam. Diesen Namen nutzte die Firma Ruf-Buchhaltung, die an der Entwicklung der Fakturiermaschine beteiligt war. Ob Logatronic oder Praetor, als Nixdorf 820 eroberte der Tischrechner die deutschen Büros und bildete den Grundstein der Nixdorf Computer AG (NCAG). Bereits 1963 hatten Nixdorfs Ingenieure damit begonnen, eine IBM-Kugelkopf-Schreibsmaschine im Dauerbetrieb zu testen und mit einer Speichereinheit zu verbinden, dann für sie einen Kontendrucker mit Magnetstreifen zu entwickeln. Im modularen Baukastensystem konnten je nach Einsatzzweck Magnetband- oder Lochkartenleser eingebaut werden. Im Jahr 1968 verkaufte man 4000 dieser Geräte allein im Inland, als die Nixdorf Computer AG entstand. Hinter dem Rücken der Manager der seit 1967 schwer angeschlagenen Wanderer-Werke hatte die Dresdener Bank als Hauptaktionär von Wanderer die Firma zum Verkauf angeboten. Das Ehepaar Nixdorf erwarb Wanderer für 8 Millionen DM und die neue Nixdorf AG übernahm Wanderer-Verbindlichkeiten von 9 Millionen DM. Während die Belegschaft der Wanderer-Werke in Köln halbiert wurde und das Werk in eine Art Dornröschenschlaf fiel, übernahm Nixdorf 70 Generalvertretungen der Firma in Deutschland und 30 Niederlassungen in Europa. Diese schlagkräftige Vertriebsorganisation war in der Lage, bis dahin gleichwertige Konkurrenten wie Kienzle oder Diehl hinter sich zu lassen. 1969 hatte die NCAG 2000 Mitarbeiter und einen Umsatz von über 100 Millionen DM. Aufstieg zur Weltfirma Die danach mit einer Floppy-Disk erweiterte Nixdorf 820 war bis Mitte der 70er Jahre der Hauptumsatzträger bei der NCAG, die sich langsam als Weltfirma präsentierte. Im westfälischen Paderborn entstand 1972 das Gebäude der Hauptverwaltung als verkleinerte Kopie des Hochhauses, das Mies van der Rohe für Seagram & Sons entworfen hatte -- es ist jetzt das HNF, in dem Nixdorfs Geburtstag heute vom Landesvater Hendrik Wüst gefeiert wird. Die Firma arbeitete mit der US-amerikanischen Entrex zusammen, welche die billigen Datenerfassungsstationen namens System 620 für Nixdorf herstellte. Sie wurden an den Magnetplattenspeicher 880, später an die Nixdorf 8850 angeschlossen. Einen spektakulären Treffer landete man 1980, als die Volkszählung in den USA mit Nixdorf-Computern und 550 Datenerfassungsstationen durchgeführt wurde. Nixdorf hatte da bereits Entrex aufgekauft. Während viele Firmen aus dieser "mittleren Datentechnik" wie Taylorix oder ICL Anfang der 80er in die Krise gerieten, blieb Nixdorf stabil. Der kantige EDV-Journalist Dieter Eckbauer schrieb über Nixdorf in seiner Computerwoche, dass der Erfolg von NCAG "eindeutig darauf beruht, Sicherheit durch Rundum-Betreuung zu verkaufen, Organisationsquark mit Sahne - keine schwarzen Kästen. Den Paderbornern muss man nicht sagen, wie die Inhaber und Geschäftsführer von Klein- und Mittelbetrieben zu packen sind." Nixdorf punktete mit seiner Vertriebsorganisation, nicht unbedingt mit Spitzentechnik. Idee für die CeBIT Dennoch begann man in den 80er-Jahren bei Nixdorf mit Überlegungen, wie der Organisationsquark mit Sahne günstiger produziert werden kann. Die enorme Fertigungstiefe mit entsprechend aufwändiger Lagerhaltung sollte gekürzt werden, die verschiedenen Betriebssysteme sollten vereinheitlicht werden. Der PC spielte dabei keine Rolle -- ein berühmtes Aperçu zu diesem Thema von Heinz Nixdorf gibt es gleich in drei nachgewiesenen Varianten: "Wir bauen keine Mopeds/Goggomobile/Mofas". Das war keine Absage an den PC, wohl aber an eine Fertigung dieser IBM- oder eben auch Apple-kompatiblen Rechner, zu der Apple eine Anfrage gestartet hatte. Mit dem Nixdorf 8810 M25 hatte man ja einen Schlepptop von Panasonic für den Außendienst im Programm. Die Strategie wies vielmehr in Richtung Unix. Heinz Nixdorf 1985 (Bild: Heinz Nixdorf Forum) Die Nixdorf Computer AG wurde 1984 Mitglied von X/Open und plante in Zusammenarbeit mit der US-amerikanischen Firma Pyramid eine Systemfamilie namens Targon, mit einer Targon /31 und einer Targon /35. Der kurz zuvor von der Informatikerin Anita Borg entwickelte fehlertolerante Rechner Nixdorf 8832 wurde kurzerhand in Targon /32 umbenannt. Doch die Computerwelt rätselte, wie sich das an den Universitäten etablierte Unix in der Bürowelt der "mittleren Datentechnik" schlagen würde. Wie diese Geschichte ausging, sollte Heinz Nixdorf nicht mehr erleben. Seinen letzten großen Erfolg feierte er, als er als langjähriger Aussteller die Hannover Messe davon überzeugen konnte, die Büromaschinen-Halle aufzulösen und als eigenständige Messe zu gestalten. Auf der ersten CeBIT im Jahre 1986 erlag er einem Herzinfarkt. Veranstaltungen im HNF zum Geburtstag Zum 100. Geburtstag von Heinz Nixdorf gibt es eine Reihe von Veranstaltungen, die vom HNF unter Nixdorf 100 aufgeführt sind. So wird heute ein neugestalteter Nixdorf-Bereich eröffnet und man kann im Foyer des Museums einen Ro 80 sehen, den sein Chauffeur und Vorschoter Josef Pieper fuhr. Vom 9. bis 13. April ist zudem der Eintritt kostenlos. Fährt man die Rolltreppen hoch ins Museum, ist auch dies ein Erbe von Heinz Nixdorf: Der energische Westfale hasste das Warten auf den Aufzug. Im November rundet ein wissenschaftlicher Kongress über Computer in Deutschland das Nixdorf-Jahr ab. (kbe)