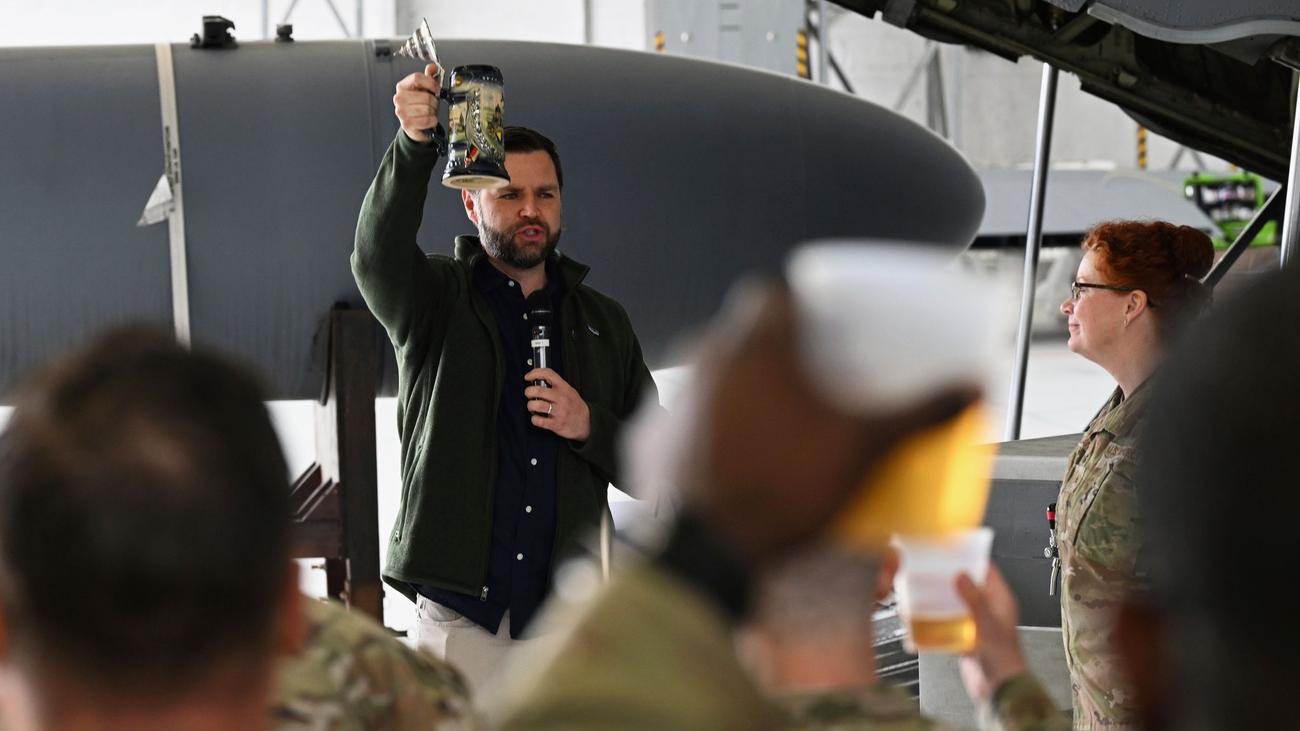Mpox: Ein totes Affenbaby führt Forscher erstmals zum Ursprung von Mpox

Es war der 27. Januar 2023, als den Forscherinnen und Forschern im Taï-Nationalpark in der Elfenbeinküste ein Mangaben-Baby auffiel, weil es Wunden an Stirn, Hinterkopf, Brust und Beinen hatte. Sie sahen, wie es zunehmend lethargisch wurde und aufhörte zu essen. Zwei Tage später war der Affe tot. In den Wochen danach erkrankten immer mehr Tiere der Gruppe, insgesamt ein Drittel der 80 Tiere entwickelte Symptome: manche nur einen Ausschlag mit ein paar Hautläsionen, anderen erging es schlechter. Vier Tiere starben. Ende April war der Ausbruch vorbei. Und die Forscher fanden heraus, was dafür verantwortlich war: das Mpox-Virus, das in Teilen Afrikas eine ernste Gesundheitsbedrohung darstellt und zuletzt auch wieder häufiger in Deutschland nachgewiesen wurde. Der Ausbruch ließ den Veterinärmediziner Fabian Leendertz vom Helmholtz-Institut für One Health in Greifswald aufhorchen. Für ihn und sein Team, das die Affengruppe schon seit Jahren beobachtet hatte, war das die Gelegenheit, um zu untersuchen, wie ein solcher Ausbruch beginnt und wo in der Natur sich das Mpox-Virus versteckt. Zwar gingen Fachleute schon lange davon aus, dass kleine Nagetiere ein Reservoir für Mpox darstellen könnten. "Aber bis jetzt hat noch nie jemand eine Infektkette nachvollziehen können", sagt Leendertz im Gespräch mit ZEIT ONLINE. Und das, obwohl Forscher das Virus bereits Ende der Fünfzigerjahre bei Laboraffen in Kopenhagen entdeckten, weswegen sie es zunächst Affenpockenvirus nannten und die Krankheit, die es auslöst, Affenpocken. 2022 löste das Virus einen weltweiten Ausbruch aus Ausbrüche des Virus gab es lange nur in afrikanischen Ländern, dort aber immer häufiger. Was auch daran lag, dass dort nach der Ausrottung der Pocken in den Achtzigerjahren weniger gegen Pocken geimpft wurde. Die Pockenimpfung schützt auch vor Affenpocken. Außerhalb Afrikas wurde der Erreger erstmals 2003 nachgewiesen, 2022 folgte dann ein globaler Ausbruch mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. In Deutschland gab es damals mehr als 3.500 gemeldete Infektionsfälle – betroffen waren hauptsächlich Männer, die Sex mit Männern hatten. Intimer Kontakt ist mittlerweile einer der hauptsächlichen Verbreitungswege des Virus. Um Stigmatisierung zu vermeiden, benannte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Krankheit in Mpox um. Während sich die Lage in vielen westlichen Ländern mittlerweile beruhigt hat, gibt es in Afrika derzeit Ausbrüche mit vier Varianten des Erregers, Kladen genannt. Besonders ein Anstieg der Klade I inklusive einer neuen Variante Ib macht den Gesundheitsbehörden Sorgen, sodass die WHO im Sommer 2024 erneut eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite ausrief. In Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo zirkulieren mehrere Kladen parallel, auch Kinder erkranken häufiger als früher. Dieses Jahr wurden bis Mitte März in Afrika insgesamt mehr als 7.000 bestätigte Fälle gemeldet, darunter 28 Todesfälle, die meisten in Uganda. Erst vor wenigen Tagen warnte ein britisches Forscherduo im Fachblatt Nature Medicine vor einem zu leichtfertigen Umgang mit dem Mpox-Virus. Die vier unabhängig voneinander anhaltenden Ausbrüche verschiedener Viruskladen und die außerordentlich hohe Rate von Übergängen vom Tier zum Menschen seien ein Risiko. Die Forscher sehen die Gefahr, dass ein Virustyp, insbesondere der Klade I, einen erneuten, aber umfassenderen weltweiten Ausbruch verursachen könnte. © Lea Dohle Newsletter Was jetzt? – Der tägliche Morgenüberblick Starten Sie mit unserem kurzen Nachrichten-Newsletter in den Tag. Erhalten Sie zudem freitags den US-Sonderletter "Was jetzt, America?" sowie das digitale Magazin ZEIT am Wochenende. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Genanalysen zeigen, dass die derzeit in Afrika zirkulierenden Mpox-Viren über viele unabhängige Übersprungereignisse von Tieren auf Menschen übergehen, bevor sich die Viren dann durch engen Kontakt unter Menschen weiterverbreiten. Deswegen suchen Forscher seit Jahren nach der tierischen Quelle des Virus. Nach einem Reservoir also, in dem der Erreger fortlaufend zirkuliert und aus dem er auf andere Tierarten – und den Menschen – übergehen kann. Kennt man das Reservoir, so die Hoffnung, lässt sich mit diesem Wissen das Risiko von Übersprüngen auf den Menschen senken – und damit auch das Risiko weiterer Ausbrüche. Eine große Chance im Taï-Nationalpark Leendertz und sein Team wussten also um ihre große Chance. Sie nahmen sowohl Proben von den verstorbenen Tieren als auch Kotproben, mit denen es ihnen gelang, zwei komplette Virusgenome zu sequenzieren – eines aus einer Probe des zuerst gestorbenen Affenbabys und eines aus einer Kotprobe von Mitte Februar. Sie sahen, dass die Sequenzen identisch waren. Ein Beleg dafür, dass der Ausbruch auf eine einzelne Quelle zurückging. Nun mussten sie diese Quelle finden. Bei der Suche kam den Wissenschaftlern zugute, dass sie die Schimpansen- und Mangaben-Populationen in den Wäldern des Taï-Nationalparks schon seit Jahrzehnten beobachten. Immer wieder hatten sie Proben genommen, um damit jene Krankheitserreger besser verstehen zu können, die für Menschen relevant sein könnten. So hatten sie über die Jahre eine Datenbank geschaffen, auf die sie nach dem Ausbruch in der Affengruppe zurückgriffen. Dabei fanden sie heraus, dass das Virus erstmals am 6. Dezember 2022 in Kotproben auftauchte, und zwar bei einem männlichen Affen namens Bako. Das Virus zirkulierte also schon lange vor der Erkrankung des ersten Jungtiers in der Gruppe. Gut möglich, dass Bako der Indexfall war, also das Tier der Gruppe, das sich zuerst angesteckt hatte. Nur wo? Ein totes Hörnchen im Wald Schon länger hatten Fachleute wie Leendertz den Verdacht, dass Hörnchen ein möglicher Wirt für das Virus sein könnten. Deswegen hatten die Forscher nicht nur Affen getestet, sondern besaßen auch Genomsequenzen von Hunderten Nagetieren, die sie seit 2019 entweder gefangen oder tot aufgefunden hatten. Und tatsächlich: Im November 2022, fast drei Monate bevor der Ausbruch unter den Affen begann, hatten die Forscher ein totes Feuerfußhörnchen entdeckt, das Mpox-positiv war. Das Virus, das die Forscher aus dem Kadaver isolieren konnten, war identisch mit jenem, das sie in den Kotproben von Bako, dem toten Baby und den anderen betroffenen Artgenossen gefunden hatten. Ein Übersprung von Hörnchen zu Affe lag also nahe. "Dann stellten wir uns natürlich die Frage: Fressen die Mangaben eigentlich Hörnchen?", sagt Leendertz. Auch diese Frage ließ sich recht schnell klären. Denn ein Kollege von Leendertz hatte vor einigen Jahren genau das gefilmt: eine Mangabe, die ein Feuerfußhörnchen verspeist. Noch dazu gelang den Forschern, gerade als sie ihren Aufsatz zum Ursprung des Virus schrieben, eine Aufnahme von einer Mangabe, die gerade ein Hörnchen fängt und dann daran knabbert. Mangaben jagen und fressen Feuerfußhörnchen Als finalen Beweis, dass das Virus von einem Hörnchen auf die Mangaben übergesprungen war, suchten Leendertz und seine Kollegen in den Kotproben der Affen nach DNA-Spuren der Nager. Und die fanden sie. In der positiven Kotprobe von Bako vom 6. Dezember wiesen sie sowohl das Erbgut des Mpox-Virus als auch Feuerfußhörnchen-DNA nach. Damit war so gut wie sicher: Ein mit dem Mpox-Virus infiziertes Hörnchen hatte den tödlichen Ausbruch unter den Mangaben verursacht. "Das Virus muss in der Hörnchenpopulation zirkuliert sein, als sich die Mangaben angesteckt haben", sagt Leendertz. Es sei bemerkenswert, wie gut die Dinge zusammenpassen. "Mit diesen Daten können wir erstmals überhaupt einen Übersprung des Mpox-Virus zwischen zwei Arten nachvollziehen." Ihre Erkenntnisse haben sie am Dienstag in einem Preprint auf der Plattform Research Square veröffentlicht. Auch wenn die Studie noch nicht von unabhängigen Fachleuten geprüft wurde, äußern sich manche Forschende euphorisch. Einen "bahnbrechenden Beitrag" zum Verständnis der Mpox-Dynamik und zur Steuerung von Präventionsmaßnahmen in Afrika und darüber hinaus nennt Yap Boum von den Africa Centers for Disease Control and Prevention die Studie gegenüber Science. Von einer "außergewöhnlichen" Detektivarbeit und überzeugenden Beweisen spricht Alexandre Hassanin, der an der Universität Sorbonne zur Evolution der Affenpocken forscht. Reservoir oder nicht? Noch nicht ganz geklärt sei aber, ob die Feuerfußhörnchen tatsächlich auch ein Reservoir für das Mpox-Virus sind, sagt Kristian Andersen, Evolutionsbiologe am kalifornischen Scripps Research Institute, gegenüber Science – also ob die Art das Virus dauerhaft in sich trägt. Theoretisch könnten sie auch im Rahmen eines größeren Ausbruchs infiziert worden sein, der von einer anderen Art ausging, sagt Andersen. In dem Fall wären die Hörnchen womöglich nur ein Zwischenwirt, der empfänglich für das Virus ist und es hin und wieder überträgt. Dennoch sei es der bisher beste Hinweis zum Reservoir des Virus, sagt Andersen. Dazu passe auch, dass sich das Verbreitungsgebiet der Tiere mit dem Gebiet überschneidet, in dem die meisten Mpox-Übertragungen stattfinden. Leendertz selbst geht nach seinen Ergebnissen und den Vorstudien von Kollegen, die infizierte Hörnchen und teils auch Antikörper in solchen Tieren gefunden hatten, davon aus, dass die Feuerfußhörnchen ein Reservoir für das Mpox-Virus sind. Die Betonung liege dabei auf ein. "Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch weitere Hörnchenarten und vielleicht auch andere Nagetierarten gibt, die als Reservoir für das Mpox-Virus fungieren können", sagt Leendertz, etwa Hamsterratten. Bushmeat ist wichtiger Teil des Lebens Leendertz will nun in weiteren Studien untersuchen, wie verbreitet das Virus in der Feuerfußhörnchen-Population ist und wie oft sie selbst daran erkranken. Und auch, ob und wie das Virus direkt vom Hörnchen auf den Menschen übergehen kann. Denn in Subsahara-Afrika ist Bushmeat, also Fleisch von wilden Tieren, nach wie vor ein wichtiger Proteinlieferant. Dazu zählten auch Hörnchen, sagt Leendertz. Mittlerweile werden auf lokalen Märkten immer mehr solche kleineren Säugetiere angeboten. Größere sind oft schon ausgestorben, weil sie bejagt wurden und ihr Lebensraum zusehends schwindet. Allerdings würden kleine Nagetiere wegen ihres geringen Werts weniger von professionellen Jägern erlegt, sondern häufig etwa von Kindern, die die Hörnchen mit ihrer Steinschleuder jagen. "Meistens kommen solche Tiere dann in die Suppe", sagt Leendertz. Nach dem Kochen sei das Virus zwar tot, aber beim Jagen, Häuten und Auseinandernehmen der Tiere sei das Risiko eines Übersprungs gegeben. Leendertz und sein Team haben die Nationalparkbehörden bereits informiert, damit diese die Dorfbewohner für die Risiken des Konsums der Hörnchen sensibilisieren, etwa in Schulen. Allerdings müsse man aufpassen, nicht nur die Hörnchen als Gefahr zu sehen, sagt der Forscher. Auch Mangaben selbst und andere mögliche Zwischenwirte würden verzehrt und stellten ein Risiko dar. Bald sollen auch Menschen in die Langzeitbeobachtung einbezogen werden, die in der Region um den Taï-Nationalpark leben, um besser zu verstehen, welche Einflüsse Übersprünge begünstigen. Zusammen mit den afrikanischen Partnern wird kontinuierlich weiter geforscht. Die neuen Erkenntnisse zeigten, wie wichtig die langfristige Überwachung der Gesundheit von Wildtieren sei, sagt Leendertz. "Ohne diese Langzeitforschung hätten wir die Übertragung niemals so sauber belegen können."