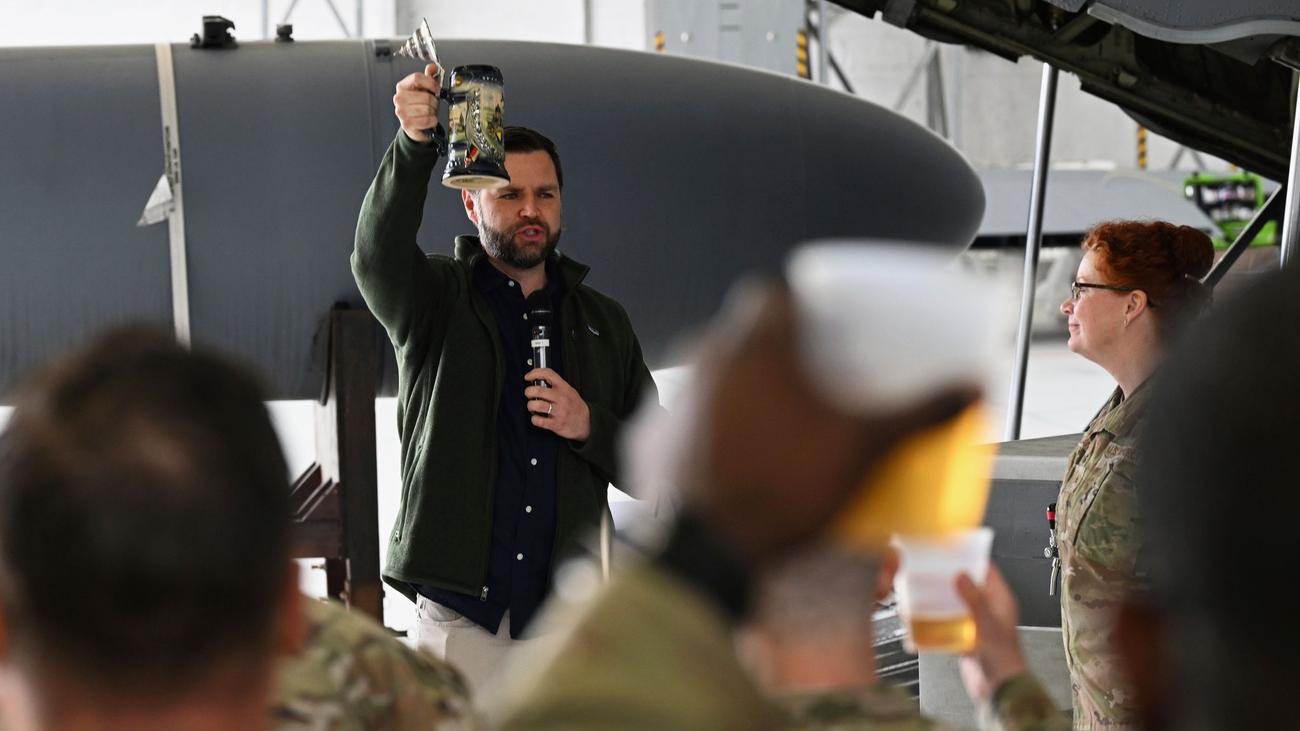Koalitionsvertrag: Digitalpakt 2.0 soll kommen

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und CSU bestätigt die Einführung eines Digitalpakt 2.0. Offen bleibt allerdings, wie viel Geld tatsächlich in diesen fließen wird. Während in vielen anderen Bereichen des Koalitionsvertrags zumindest ein ungefähres Milliarden-Volumen angegeben wird, bleibt dies im Bildungsbereich unbenannt. Anzeige Kaum überraschend bekennt sich der Koalitionsvertrag zwischen CDU, SPD und CSU zum Bildungsföderalismus, will aber weiterhin eine bessere Zusammenarbeit und auch größere Vergleichbarkeit im Bildungssystem erzielen. Dieses Ziel ist ein fortwährendes auf Bundesebene. Man möchte die Zusammenarbeit "effizienter gestalten". Bund, Länder und Kommunen sollen zudem zusammenkommen und etwa "konstruktive Kooperationen vereinbaren". Messbare Bildungsziele, Bildungsverlaufsregister und Schüler-ID Formuliert wurde außerdem, dass Bund und Länder "für die nächste Dekade relevante und messbare Bildungsziele vereinbaren". Auch soll es eine datengestützte Schulentwicklung geben und ein Bildungsverlaufsregister geschaffen werden. Damit soll besser verstanden werden, wie Bildungsbiografien in Deutschland verlaufen und beispielsweise an welchen Weggabelungen Abstiege oder Aufstiege typisch sind, oder auch durch bestehende Systeme gefördert oder verhindert werden. Des Weiteren soll eine zwischen den Ländern kompatible, "datenschutzkonforme Schüler-ID" eingeführt werden. Die Koalitionäre wollen hier auch die Verknüpfung mit der Bürger-ID ermöglichen. Wenig Konkretes zum Digitalpakt 2.0 Mit dem Digitalpakt 2.0, dessen Fortführung noch im Dezember 2024 unter der Rest-Ampelregierung versprochen wurde, soll die digitale Infrastruktur weiter ausgebaut werden, zugleich wird aber auch eine "verlässliche Administration" erwähnt. Hier wäre es spannend, was genau sich die Koalition darunter vorstellt. Werden Gelder für die IT-Administration verstetigt und von Digitalpakten entkoppelt? Weiter heißt es zum Digitalpakt 2.0: "Wir bringen anwendungsorientierte Lehrkräftebildung, digitalisierungsbezogene Schul- und Unterrichtsentwicklung, selbst-adaptive, KI-gestützte Lernsysteme sowie digitalgestützte Vertretungskonzepte voran." Auch hier wären genauere Ausführungen zu den einzelnen Punkten interessant gewesen. Anzeige Zumindest zwei Aussagen sind einigermaßen konkret: Der Abrechnungszeitraum für "angefangene länderübergreifende Maßnahmen" werde "um zwei Jahre" verlängert. Und bedürftige Kinder werden wohl weiterhin mit Endgeräten ausgestattet. Leise Hoffnung könnte auch bezüglich maroder Schulgebäude aufkommen. Hierfür soll es ein Investitionsprogramm geben, "um bei der Sanierung und Substanzerhaltung von Schulen und der Schaffung neuer Kapazitäten zu unterstützen." Wie viel Geld hierfür zur Verfügung stehen soll, bleibt aber unbeantwortet. Lesen Sie auch Impulspapier: Die Vermessung der Bildungsempfänger und -institutionen Nicht zuletzt findet auch die aktuelle Smartphone-Debatte an Schulen ihren Eingang in den Koalitionsvertrag, geht es dabei doch auch um psychosoziale Schwierigkeiten, mögliche Konzentrationseinbußen im Unterricht und Störungen des Schulalltags. "Die Auswirkungen von Bildschirmzeit und Social-Media-Nutzung bewerten wir schnellstmöglich wissenschaftlich und erarbeiten ein Maßnahmenpaket zur Stärkung von Gesundheits- und Jugendmedienschutz." Eine kritische Bewertung könnte zu übergreifenden Regeln führen, welche die private Nutzung von Smartphones in Bildungseinrichtungen stärker beschränken. Digitale Bildung für die Allgemeinheit Die neuen Koalitionäre betonen in ihrem Vertrag, dass der kritische Umgang mit digitalen Tools und Medien die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft steigere und dass dies nicht nur ein Thema für die Jugend sei. Deshalb werde eine "altersübergreifende digitale Kompetenzoffensive" gestartet. Mithilfe von Start-ups, Wirtschaft, öffentlichen Bildungsträgern und Sozialverbänden, sollen "innovative und nachhaltige Angebote für alle Bevölkerungsgruppen" geschaffen werden. Eine Bundeszentrale für digitale Bildung, wie sie während der Koalitionsverhandlungen vom Bitkom gefordert wurde, findet sich in diesen Ausführungen nicht. Die Regierungsparteien versprechen ferner eine digitale Teilhabe für alle und eine Stärkung der Barrierefreiheit. Um eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für Heranwachsende zu erreichen, sollen Kinder über eine Teilhabe-App einen unbürokratischen Zugang zu besonderen schulischen Angeboten sowie Sport-, Musik-, Kultur- und sonstigen Freizeitangeboten erhalten. Für den MINT-Bereich will die Koalition die frühe MINT-Bildung sowie den Wettbewerb "Jugend forscht" ausbauen. Lesen Sie auch Koalitionsvertrag: Wirtschaft hoffnungsvoll, Entsetzen bei Bürgerrechtlern (kbe)