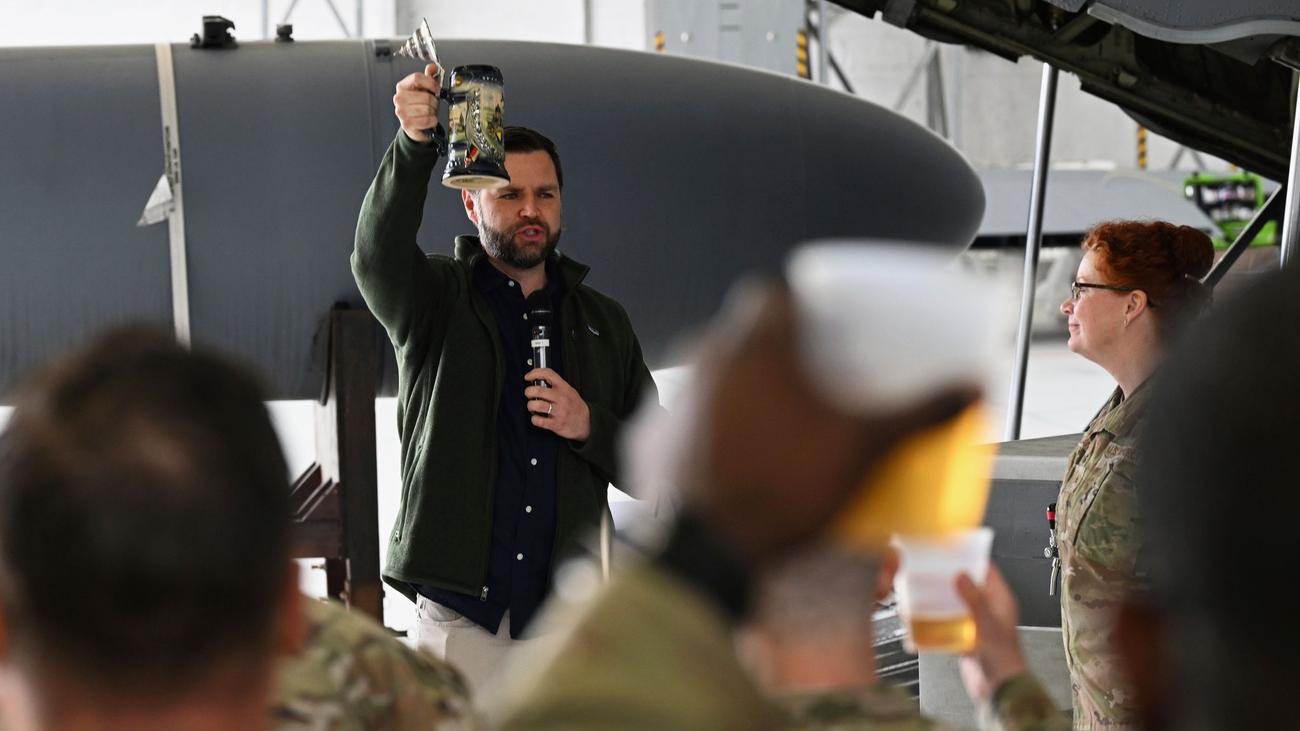Zollstreit zwischen USA und China: Droht Europa jetzt eine Flut von Billigprodukten aus China?

Pause im Zollstreit – jedoch nicht für China: Während US-Präsident Donald Trump die meisten Einfuhrzölle für 90 Tage pausiert, gleichen die Zollbarrieren zwischen China und den USA mittlerweile Festungen: 145 Prozent erheben die USA auf chinesische Produkte, sie werden durch den Zoll im Einkauf also mehr als doppelt so teuer wie bisher. China berechnet ab Samstag einen Zoll von 125 Prozent auf US-Produkte. Das dürfte vor allem Verbraucherinnen und Verbraucher in beiden Ländern hart treffen. Aber nicht nur die: "Der unmittelbare Handelsschock für Asien wird wahrscheinlich auch nach Europa zurückwirken", sagte kürzlich der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Robin Winkler, der Financial Times. Die Sorge: Weil China seine Produkte nicht mehr in den USA loswird, weicht die Volksrepublik vermehrt auf andere Absatzmärkte aus. Droht die EU nun von Billigprodukten aus China überschwemmt zu werden? Gardinen im Wert von 638 Millionen US-Dollar Die USA sind nach den zehn Mitgliedsländern des Verbandes südostasiatischer Staaten (Asean) der wichtigste Absatzmarkt für China. 2024 exportierte die Volksrepublik Waren in Wert von 438,9 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten – 5,8 Prozent mehr als im Jahr zuvor und mehr als in jedes andere Land der Welt. Der größte Anteil an den Exporten in die USA hat Elektronik: Smartphones, Computer, Spiegelreflexkameras, Fernseher, Beamer, Drucker – die Liste der Produkte, die im US-amerikanischen Alltag gebraucht werden und aus China stammen, ist lang. Dazu kommen vor allem weitere Gegenstände des täglichen Gebrauchs, zum Beispiel Plastikspielzeuge, Brettspiele, Möbel, Textilien, Schuhe, Schüsseln, Spiegel. Im Jahr 2023 exportierte China Gardinen im Wert von allein 638 Millionen US-Dollar in die Vereinigten Staaten. © ZEIT ONLINE Newsletter ZEIT Geldkurs Tschüss, Finanzchaos: In acht Wochen erklären wir Schritt für Schritt, wie Sie bessere Geldroutinen aufbauen und das mit den ETFs endlich angehen. Anschließend erhalten Sie unseren Geld-Newsletter mit den besten Artikeln rund um Finanzen. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Die chinesischen Produkte sind also auch in den USA allgegenwärtig. Und werden sie bei der Einfuhr teurer, dann sinkt ihre Attraktivität für Verbraucher. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sie niemand mehr kaufen würde. "Die Produkte werden gebraucht, und so schnell können die USA keine heimische Produktion aufbauen, falls so etwas überhaupt möglich wäre", sagt Max Zenglein, Ökonom und Leiter des Bereichs Wirtschaft am Mercator Institute for China Studies (MERICS) in Berlin. "Das bedeutet also vor allem: Die Inflation in den USA geht durch die Decke." Neue Absatzmärkte müssen her Sinkt dadurch die Kaufkraft und weichen Konsumentinnen und Konsumenten auf andere Produkte aus, je länger der Zollstreit andauert, steigt jedoch auf China tatsächlich der Druck, neue Absatzmärkte zu finden. Viele Optionen gibt es nicht: Noch mehr in den Staaten des Asean-Verbandes absetzen – also Indonesien, Vietnam, Philippinen? Oder auf dem afrikanischen Kontinent? Oder Südamerika? Die Kaufkraft in diesen Regionen ist viel geringer als in den USA. Zudem: "Die Schwemme von chinesischen Gütern ist in vielen Ländern des Globalen Südens schon lange ein Problem", sagt Ökonom Zenglein. "China wird Alternativen suchen müssen." Und hier könnte die EU ins Spiel kommen: Bereits jetzt sind die EU-Staaten der drittwichtigste Absatzmarkt nach Asean und den USA. Ob europäische Unternehmen nun mit einem Preiskampf konfrontiert werden, komme jedoch auf die Branche an, sagt Max Zenglein von MERICS. "Konsumgüter wie zum Beispiel Spielzeugautos werden in der EU kaum noch hergestellt", sagt er, das Gleiche gelte für Solarpanels, die meisten Smartphones oder Flachbildfernseher. "In der EU wäre also gar kein Unternehmen von höheren Importen aus China betroffen." Sorge im Maschinenbau und der Chemieindustrie Anders in Branchen, die mit chinesischen Herstellern im Wettbewerb stehen – der Maschinen- und Anlagenbau oder die Chemieindustrie zum Beispiel. "Da würde sich so ein Preisverfall bemerkbar machen", sagt Zenglein. Der Verband der Chemischen Industrie (VCI) etwa erwartet, dass die Zollkrise eine "Neuausrichtung von Handelsströmen zur Folge" haben werde. Das müsse genau beobachtet werden. "Gerade China mit seiner großen Chemieindustrie und seinem großen Chemiemarkt" werde im Zentrum der Beobachtung stehen, teilt der VCI mit und fügt an: "Ein alleiniger Fokus auf China wäre aber zu verengt." Ähnlich im Maschinen- und Anlagenbau: Wolfgang Niedermarkt, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), verwies in einem Statement auf die EU: Die müsse nun koordiniert reagieren, "um Umleitungseffekten im internationalen Handel zu begegnen". EU erwägt wohl Einfuhrkontingente Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verspricht, genau das zu tun: Man werde die Unternehmen vor "indirekten Auswirkungen" der "Handelsumlenkung" schützen, sagte von der Leyen Anfang der Woche nach einem Treffen mit dem Ministerpräsidenten von Norwegen. Dafür werde die Kommission eine "Einfuhrüberwachungstaskforce" einrichten – diese solle in engem Austausch mit der Industrie überprüfen, ob vermehrt billige Konkurrenzprodukte aus China den Markt fluten. Und dann gegebenenfalls handeln. Wie genau eine Reaktion aussehen könnte, dazu gibt es bislang keine offizielle Stellungnahme. Einfuhrkontingente könnten eine Option sein, wie das Handelsblatt aus Kommissionskreisen erfahren haben will. Das bedeutet: Sobald eine bestimmte Menge oder ein bestimmter Warenwert aus China über die Grenze geführt wurde, wäre Schluss. Das klingt nach einer drastischen Maßnahme, wäre aber nur konsequent. Denn immer wieder sorgt Chinas Exportstrategie – und der damit verbundene Handelsüberschuss – für Kritik, eben auch aus der EU. So prüft die EU-Kommission etwa derzeit, inwieweit der chinesische Versandhändler Temu gegen EU-Standards verstößt, auch Einfuhrzölle sind im Gespräch. Und auf chinesische E-Autos gibt es bereits Zölle, teilweise von bis zu 40 Prozent. Pausiert ist der Zollstreit also längst nicht – er hat sich nur verlagert. Korrekturhinweis: In einer ursprünglichen Version des Textes war die Verteuerung der Produkte in China mit dem Anderthalbfachen angegeben, sie werden im Einkauf jedoch mehr als doppelt so teuer. Wir haben den Fehler korrigiert und bitten, diesen zu entschuldigen. Zudem haben wir den Zollsatz Chinas auf US-Produkte aktualisiert. (faf, 11. April 2025)