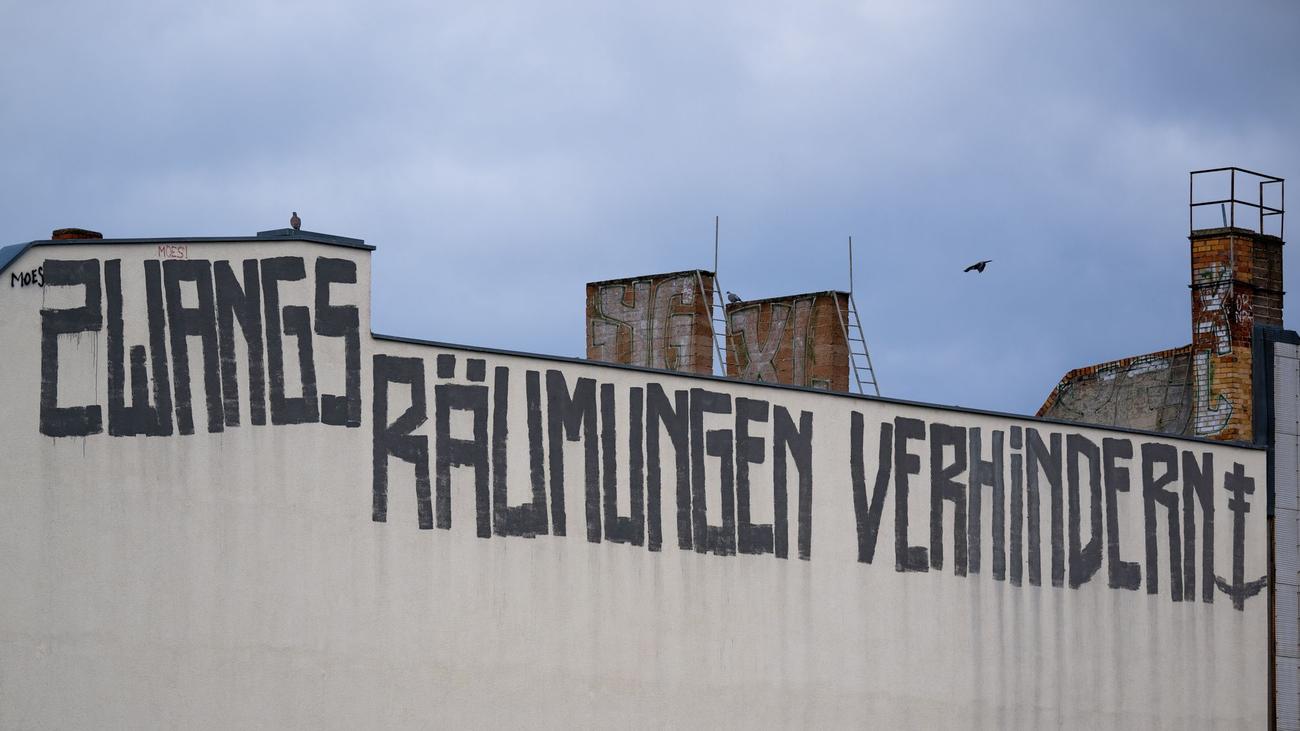Cannabisanbau im Studium: Higher Education

Christopher öffnet die große schwarze Box in seinem WG-Zimmer nur, wenn es unbedingt sein muss. Denn der grüne Schatz darin braucht es warm und feucht. An diesem Januartag aber geht es nicht anders, er hat ihn über Weihnachten zu lang allein gelassen. Christopher wäscht sich im Bad nebenan die Hände, desinfiziert seine Schere und öffnet langsam den Reißverschluss der Box. Der unverwechselbare, erdig-säuerliche Duft strömt ins Zimmer. "Cannabis mag keine Helikoptereltern", sagt er und schneidet vorsichtig zwei Blätter mit braunen Flecken ab. "Aber sie sind schon glücklicher, wenn ich da bin." Die Box ist eine Art aufklappbares Gewächshaus: 25 Grad warm, 38 Prozent Luftfeuchtigkeit, grelles Licht, das die Sonne simuliert. Darin stehen zwei Töpfe, in die Christopher vor fünf Wochen Cannabissamen gedrückt hat. Heute sind die Pflanzen schon so hoch wie ein DIN-A4-Blatt und sein ganzer Stolz. Wenn sich das Licht in der Box um 19 Uhr automatisch anschaltet, sagt Christopher ihnen Guten Morgen: "Ich lobe sie, sage, dass sie toll aussehen und so weitermachen sollen." Christopher Schik ist 26 Jahre alt und aus akademischer Sicht ein Pionier. Er ist einer der ersten Deutschen, die Cannabisanbau studieren können. Seit Oktober 2024 ist das an der FH Erfurt möglich, als Wahlpflichtmodul im Bachelor Gärtnerischer Pflanzenbau. 46 Erstis haben sich im Wintersemester für diesen Studiengang eingeschrieben, zwölf davon nur wegen des neuen Moduls. Christopher ist einer davon. © ZEIT Campus Newsletter ZEIT CAMPUS-Newsletter Studieren, Leben, Arbeiten: Hol‘ dir die besten Texte von ZEIT CAMPUS in dein Postfach! Jeden Dienstag frisch aus der Redaktion. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . An einem Nachmittag im Januar sitzt er mit seinen Freunden Philipp, Moritz und Jonas und den anderen Erstis in einem verglasten Vorlesungsraum ihrer Hochschule. Um Cannabis geht es heute leider noch nicht. Sie müssen erst die Gartenbau-Grundlagen verstehen: Technik, Ökonomie, Biologie, Chemie und Ökologie. Denn aus diesen Wissenschaften setzt sich später das Gras-Modul zusammen. Frederik Langner, Dozent für Gartenbautechnik, teilt Testaufgaben von alten Klausuren aus. Drei Wochen sind es noch bis zur ersten Prüfung. Gemeinsam tasten sie sich den Lösungsweg entlang, das Ergebnis wirft Langner über den Beamer an die Wand. Die Erstis schreiben hektisch mit. Manche von ihnen haben schon ein Studium oder eine Ausbildung hinter sich, andere haben erst im vergangenen Sommer ihr Abitur geschafft. Christopher zeichnet mit Bleistift in einem Diagramm ein, wie stark die Temperatur fällt, wenn Pflanzen über die Luft befeuchtet werden. Vor einem halben Jahr hat er noch Englisch und Geschichte auf Lehramt in Tübingen studiert, aufgewachsen ist er ganz in der Nähe, auf der Schwäbischen Alb. Es sei ihm nicht schwergefallen, dieses Studium abzubrechen, sagt er. "Im Lehramt gab es kaum Praxis, das ist hier ganz anders." Schon seit der Oberstufe ist Christopher fasziniert von der Cannabispflanze, seit der Legalisierung probiert er sich im Anbau. In seiner konservativen Heimat auf der Alb sehe man das Thema eher kritisch. "Doch mittlerweile konnte ich zumindest meine Eltern und meine engsten Freunde überzeugen, dass wir hier nicht Kiffen lernen, sondern echte Wissenschaft", sagt er. Cannabisanbau zu studieren, war lange so undenkbar wie ein Abschluss in Steuerhinterziehung oder Ladendiebstahl. Die Pflanze zählte in Deutschland zu den Betäubungsmitteln. Das änderte sich im Februar 2024, als der Bundestag auf Initiative der Ampel die Legalisierung beschloss. Seit dem 1. April vergangenen Jahres dürfen Erwachsene bis zu drei Pflanzen für den Eigenbedarf halten, mehr Ärzt:innen können Cannabis therapeutisch verschreiben. Für Hersteller, private Anbauer und Social Clubs, die sich dann gründen durften, ist dieser Schritt ein Triumph. Wie schnell ein Milliardenmarkt entstehen kann, zeigen Länder wie Kanada oder die USA. Dort ist Cannabis seit 2018 für den Freizeitgebrauch legal. In Amerika wurden im vergangenen Jahr 42 Milliarden Dollar mit Cannabis umgesetzt. Politiker wie Friedrich Merz halten die Legalisierung in Deutschland für falsch und wollen sie rückgängig machen: Die Gesetzesänderung befeuere Beschaffungskriminalität und fördere den Missbrauch dieser Einstiegsdroge. Christopher, Philipp, Jonas und Moritz stehen nach der Vorlesung draußen im Schneeregen, Jonas zündet sich eine Zigarette an. Sie fachsimpeln, wie sie den Terpengehalt ihrer Pflanzen erhöhen können, welche Firma den besten Abluftfilter herstellt oder wie man am meisten Extrakt aus der Pflanze bekommt. Christopher ist Experte auf diesem Gebiet: Zu Hause erhitzt er die Blüten und vermischt sie dann in einer Petrischale mit hochprozentigem Alkohol. Dann heißt es warten, bis Cannabinoide und Terpene extrahiert sind und eine klebrige Flüssigkeit entstanden ist, die an Honig erinnert. Studiengangsleiter Wim Schwerdtner will, dass seine Studierenden im Gewächshaus THC-freien Hanf anbauen können. © Robert Kwaß Alle vier wollen später im Cannabisgeschäft arbeiten. Philipp möchte Krebspatient:innen helfen und dafür Erfahrungen bei der Firma Cannabiotics in Los Angeles sammeln. "Die stellen High-End-Blüten her", sagt er. Moritz findet CBD-Produkte spannend, Jonas will Freizeithanf herstellen, Sorten miteinander kreuzen, wie es heute schon in Kanada passiert. Und Christopher will sich mit seinem Wissen selbstständig machen, hochwertiges Gras und Extrakte herstellen und handeln. Für alle, die wie er selbst lieber einen Joint rauchen, als ein Bier zu trinken. Vom deutschen YouTube-Kanal "GreenConnection" hat Christopher gelernt, welches Equipment er für den Anbau braucht. Mit Videos des kanadischen YouTubers "Mr. Canucks Grow" hat er sich beigebracht, wie er seine Pflanzen am besten schneidet. In anonymen Foren verfolgt er die Posts von Growern, wie sich die Selbstanbauer nennen, die ihre Tricks teilen und ihre Fortschritte fotografieren. "Man weiß nicht, was passiert, wenn die CDU bald alles wieder kippt", sagt Christopher, "immerhin ist unser Studiengang safe." Zur Not könnten sie nach dem Abschluss nach Spanien oder Kanada gehen. "Die Wissenschaft ist zu hundert Prozent auf unserer Seite. Ich steh moralisch hinter der Legalisierung", sagt Jonas. Und auch hinter seinem eigenen Konsum: Schon in der Schule habe er dazu gestanden, dass er kifft, er hatte "keinen Bock" auf Stigmatisierung. Auf die Frage, wie oft sie gerade konsumieren, antworten alle: "Gar nicht." – "Ist doch Klausurenphase", sagt Philipp. "Bald schreiben wir Chemie, das ist der Endgegner", sagt Christopher. "Extrem hohe Durchfallquote", sagt Moritz. An dieser Stelle ist ein externer Inhalt eingebunden Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Weiter Wim Schwerdtner ist so was wie der Züchter des Erfurter Cannabismoduls. Er leitet den Studiengang. Noch sind die Hanfpflanzen in seinem akkurat aufgeräumten Büro aus Plastik. "Mehr ist an einer Hochschule nicht erlaubt", sagt er. Der Agrarwissenschaftler setzt sich dafür ein, dass seine Studierenden THC-freien Industriehanf im Gewächshaus der FH anbauen dürfen. Wie lang das Genehmigungsverfahren dauern wird, kann Schwerdtner nicht einschätzen. Damit die Studierenden in der Zwischenzeit trotzdem Praxis erleben, organisieren Schwerdtner und seine Kolleg:innen Exkursionen zur Hanfmesse Mary Jane in Berlin oder zu Aurora, einer kanadischen Firma, die auch in Deutschland medizinisches Cannabis anbaut. Drei Tage vor der Exkursion zu dieser Firma sitzen nur sieben Studierende von 33 angemeldeten in der Vorlesung zu Techniken im Cannabisanbau. "Die meisten von ihnen sind wohl noch in der Heimat eingeschneit", sagt Frederik Langner und schaltet den Beamer ein. Heute geht es um Trimmungs- und Trocknungsmethoden. An einer fast leeren Tischreihe sitzt Enya Schulze. Sie ist 22, studiert im dritten Bachelorsemester und sagt: "Hätte ich vorm Studium gewusst, dass es das Cannabisseminar geben wird, wäre ich an eine andere Uni gegangen. Ich hatte ein sehr negatives Bild und wollte nichts mit der Droge zu tun haben." Das hat sich durch den Besuch auf der Hanfmesse in Berlin geändert. Weil Enya den Instagram-Account des Studiengangs betreut, fuhr sie im vergangenen Juni mit den anderen zur Messe. Durch den Austausch mit Züchter:innen und Händler:innen habe sie eine neue Perspektive bekommen. "Die Anwendungsmöglichkeiten von Hanf sind unendlich: als Dämmung, Nahrung, Faser, sogar für die Segelmacherei. Und alles nachhaltig", sagt Enya. Hanf gehört heute neben Tomaten zu ihren Lieblingspflanzen. Als Rausch- oder Genussmittel konsumiert sie die Pflanze nicht. Neben Cannabis ist die Tomate Enyas Lieblingspflanze: "Weil es von ihr unendlich viele Sorten gibt." Ihre Zeit verbringt sie am liebsten im Gewächshaus, mit den Händen in der Erde. © Robert Kwaß Am Morgen der Exkursion steht Enya um 8.30 Uhr verschlafen und fröstelnd mit neun Kommiliton:innen und Dozent Frederik Langner vor dem Gebäude der FH. Die Autofahrt zu Aurora, dem Cannabisproduzenten, dauert eineinhalb Stunden. Auf dem Industriegelände Chemiepark Leuna in der Nähe von Halle baut Aurora seit 2022 medizinisches Cannabis an. Bislang durften sie nur eine Tonne pro Jahr produzieren. Bleibt es bei der Legalisierung, könnte die Firma ihre Produktion ausbauen. Nach der Ankunft gibt es erst mal Geschenke für die Studierenden: einen Block, einen Stift, einen orangen Grinder – eine Kräutermühle, Grundausstattung von Kiffern. Dirk Heitepriem von Aurora Europe hat die Studierenden eingeladen. Er führt sie durch die Anlage, über Flure und an Konferenzräumen vorbei. Alles ist weiß, steril. Das Licht erinnert an Krankenhaus, es riecht nach Putzmittel und frischer Farbe. "Wer von euch baut an?", fragt Heitepriem in die Runde. Sieben Hände gehen nach oben. "Dann wisst ihr, dass es kein Hexenwerk ist, Genussmittelcannabis anzubauen. Aber bei medizinischem ist das anders", sagt er. Den Unterschied wolle er ihnen heute zeigen. Für 350 Euro hat Christopher sein Homegrow-Equipment im Internet bestellt. Seine Mitbewohnerinnen störe das grüne Hobby nicht, "solange ich in der WG nicht rauche", sagt er. © Robert Kwaß Er öffnet eine dicke Tresortür. Die Studierenden müssen sich grüne Overalls, Handschuhe und Haarnetze anziehen, damit die Pflanzen nicht kontaminiert werden. Durch eine Schleuse geht es weiter in die Produktionsräume. Auf 3.600 Quadratmetern, etwa der Hälfte eines Fußballfelds, wird Cannabis angebaut, geerntet, getrocknet, desinfiziert. Der Standort in Deutschland sei ein Investment, sagt Heitepriem. "Hier wird angebaut, ausgebildet und aufgeklärt." Das heißt aber auch: Direkt verdient wird hier nicht viel. Weltweit produziert die Firma 42 Tonnen medizinisches Cannabis im Jahr, nur eine Tonne kommt bislang aus Deutschland. Heitepriem ist seit drei Jahren bei Aurora, war davor in der politischen Beratung und ist Mitglied der SPD. 2023 sprach er vorm Gesundheitsausschuss des Bundestags als Experte über Cannabis, plädierte für eine Legalisierung. "Ich bin überzeugt, dass der Anbau in Deutschland eine Zukunft hat", sagt Heitepriem vor den Studierenden, die applaudieren. Der Chemiepark Leuna ist für Aurora eine Bühne, auf der das Unternehmen zeigen will, was in Deutschland möglich wäre. Eine Bühne, auf der es beweisen will, dass Cannabis nicht schmutzig und kriminell sein muss, sondern Menschen mit Krebs, ADHS oder Endometriose den Alltag erleichtern kann. Bevor der Bundestag das Cannabisgesetz verabschiedete, waren auch einige Politiker:innen auf den Fluren von Aurora unterwegs, etwa Karamba Diaby von der SPD. Die Pflanzen von Aurora haben alle dieselbe kanadische Mutterpflanze. So will die Firma den Qualitätsstandard halten. Die Studierenden gehen von Raum zu Raum. Im ersten wachsen die Stecklinge in Würfeln aus Steinwolle, sie sind nicht länger als ein Finger. Wenn sie nach ein paar Wochen groß genug sind und Wurzeln gebildet haben, dürfen sie in den nächsten Raum umziehen. Hier ist es so hell, dass sich Heitepriem eine Sonnenbrille aufsetzt, bevor er die Tür öffnet. LED-Lampen ersetzen das Sonnenlicht, es ist warm, ältere Pflanzen stehen auf Tischen. Sie sind bereits einen halben Meter groß, haben aber noch keine Blüten gebildet. Deshalb riecht es auch nur nach Gewächshaus. Die Pflanzen im nächsten Raum haben schon Blüten. Ein Netz aus dünnen Seilen sorgt dafür, dass sie gerade nach oben wachsen. Ein starker säuerlicher Geruch strömt den Studierenden entgegen. "Da steckt der Wirkstoff drin", sagt Heitepriem, schneidet eine Blüte ab und reicht sie den Studierenden. Die Homegrower tasten und schnüffeln. "Diese Qualität würde ich zu Hause nie hinkriegen", murmelt einer. Mitnehmen dürfen sie die Blüte zur ihrer Enttäuschung nicht, sie wird mit anderen Produktionsabfällen verbrannt. An vielen Räumen hängen noch rote "Gesperrt!"-Schilder. Der Standort ist für größere Ernten ausgerichtet, als bislang erlaubt sind. Aurora hatte beim Bau des Werks im Mai 2022 mit der Legalisierung spekuliert. Ob hier bald neue Sorten wachsen dürfen, wird sich bei der Bundestagswahl entscheiden. In den Tagen der Exkursion, ein paar Wochen vor der Wahl, liegt die Union in Umfragen deutlich vorn. Nicht nur Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat sich gegen Cannabis ausgesprochen, auch im Wahlprogramm wurde ankündigt, die Legalisierung rückgängig machen zu wollen. Trotzdem ist Heitepriem nicht nervös: "Auch die Union wird einen Koalitionspartner brauchen. Ich glaube nicht, dass die anderen Parteien die Legalisierung opfern werden." Außerdem sei die rechtliche Wiedereinstufung als Betäubungsmittel sehr kompliziert. "Es wird sicher einige Restriktionen geben, die werden aber wahrscheinlich eher die Anbauvereinigungen, Homegrower oder die Besitzmenge betreffen", glaubt Dirk Heitepriem. Zum Abschied sagt der Aurora-Mann: "Wir sind wirklich begeistert, dass es euch in Erfurt gibt. Ihr werdet für einen Innovations- und Wissensschub sorgen." Dann erinnert er an zwei Praktikumsstellen, die sein Unternehmen gerade ausgeschrieben habe. Zwei der Studenten haben sich schon beworben. "Ich könnte dort niemals arbeiten", sagt Enya auf dem Weg zurück. "Viel zu klinisch. Ich brauche den Dreck unter meinen Fingernägeln." Trotzdem habe sie Respekt vor der Arbeit von Aurora: "Die Präzision, mit der sie anbauen, ist beeindruckend." Auf Exkursionen wie diese muss Christopher noch ein halbes Jahr warten. Jetzt muss er erst mal die Chemieklausur schaffen.