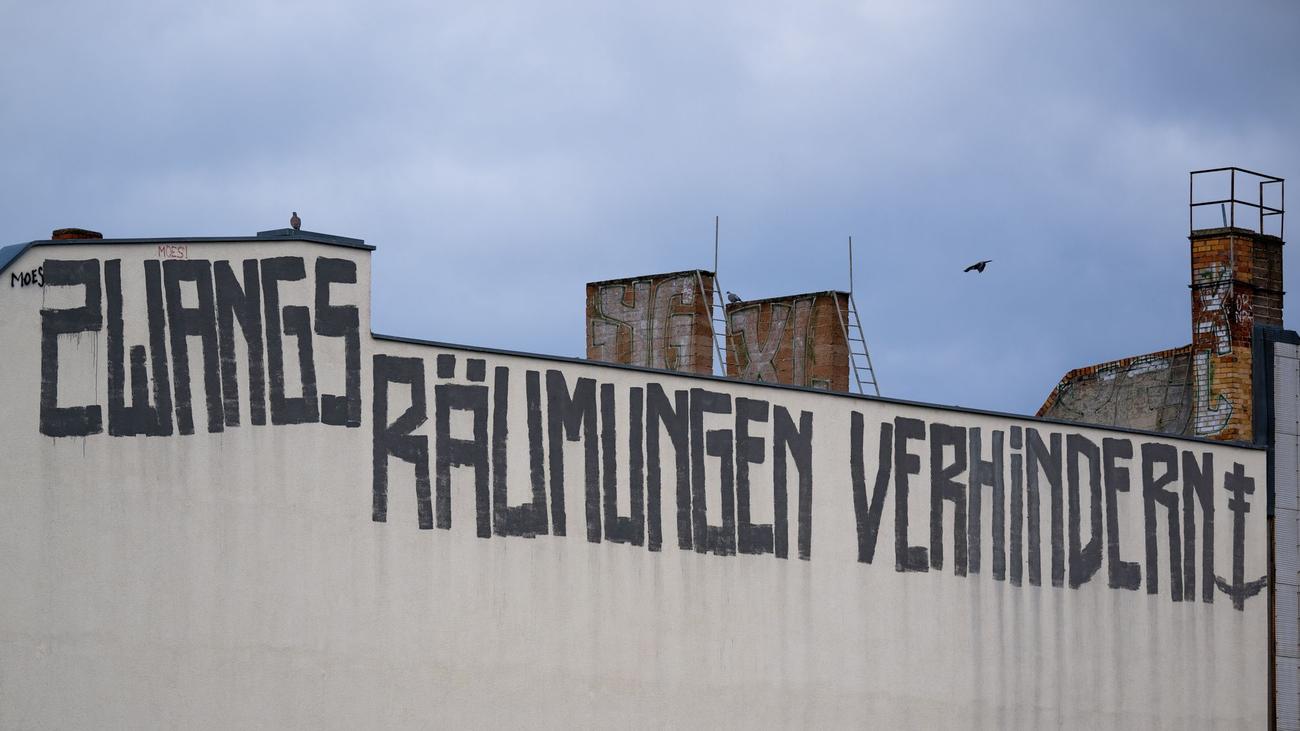Interview: Digitale Souveränität ja – aber ohne Beschränkung auf Open-Source

Mit der rabiaten US-Politik unter Präsident Donald Trump hat die Debatte, wie sehr die hiesige IT von US-Anbietern abhängt, an Schärfe gewonnen. Sind die USA überhaupt noch ein zuverlässiger Partner? Und was sind die Alternativen? Darüber sprach die iX-Redaktion mit Oliver Grün, dem Präsidenten des Bundesverbands IT-Mittelstand e. V., kurz BITMi. Der BITMi ist ein deutscher Lobbyverband für mittelständische IT-Unternehmen und repräsentiert eigenen Angaben nach rund 2500 Unternehmen aus der deutschen Digitalbranche. Das Interview fand via E-Mail statt. Anzeige Herr Grün, wie abhängig sind Verwaltung und Unternehmen in Deutschland von den US-Anbietern? Eine Studie der Universität Bonn ordnet Deutschland der Gruppe an Ländern zu, die am zweitstärksten von digitalen Technologien aus dem Ausland abhängig und damit hoch vulnerabel sind. Dabei sind wir neben chinesischen IKT-Produkten vor allem von amerikanischen Informationsinfrastrukturen wie etwa Cloud-Diensten, Suchmaschinen und Computersoftware, abhängig – und das auch in kritischen Bereichen, wie die Nutzung von Microsoft- und Amazon-Clouddiensten durch die Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache sowie die Nutzung der AWS Cloud durch die Deutsche Bahn zeigt. Besorgniserregend ist diese Abhängigkeit insbesondere jetzt, da sich die USA zunehmend als unzuverlässiger Partner erweisen und EU-Regulierungen wie den Digital Services- und Digital Markets Act offen attackieren. Vor diesem geopolitischen Hintergrund ist es besonders die Einseitigkeit der Abhängigkeit, die uns verwundbar macht. Denn daraus entsteht die Gefahr der Erpressbarkeit. Es besteht also dringender Handlungsbedarf, um unsere digitale Selbstbestimmung und Resilienz zu sichern. Und was sollte an kurzfristigen Maßnahmen auf der Roadmap für einen Umstieg stehen? Kurzfristig kann bei der Einführung neuer Lösungen für die Verwaltungsdigitalisierung auf den europäischen Anbietermarkt gesetzt werden. Dafür empfiehlt der BITMi eine Souveränitätsklausel in der öffentlichen Vergabe, die sicherstellt, dass bei gleichem Leistungsumfang das Produkt gewählt wird, das die digitale Souveränität stärkt und die Einhaltung europäischen Rechts sowie die Datenhoheit garantiert. Gleichzeitig ist Technologieoffenheit essenziell – eine Beschränkung auf bestimmte Technologien, etwa Open Source, würde einen Großteil des heimischen Marktes ausschließen. Angesichts der Dringlichkeit der Lage können wir uns das nicht leisten. Eine weitere Sofortmaßnahme ist ein zweijähriger Einführungsstopp neuer Regulierungen auf Bundes- und EU-Ebene. Denn unsere heimische Digitalwirtschaft, die der Schlüssel für unsere digitale Souveränität ist, besteht zum Großteil aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Diese werden durch Regulierungen unverhältnismäßig belastet und haben damit einen Nachteil gegenüber amerikanischen Tech-Konzernen, die Compliance-Kosten und bürokratischen Aufwand leicht wegstecken und zudem in ihren Heimatmärkten viel weniger Regulierungen ausgesetzt sind. Mittel- bis langfristig wäre über einen Regulierungsstopp hinaus auch der Rückbau von Regulierungen wirksam, zum Beispiel durch eine Mittelstandsausnahme vom AI Act. Anzeige iX Newsletter: Monatlich spannende Hintergründe zur neuen Ausgabe Kennen Sie schon den kostenlosen iX-Newsletter? Jetzt anmelden und monatlich zum Erscheinungsdatum nichts verpassen: heise.de/s/NY1E In der nächsten Ausgabe geht's ums Titelthema der Mai-iX: So werden Sie ohne Malware angegriffen. Wären deutsche und EU-Anbieter überhaupt in der Lage, US-Anbieter in puncto Preis und technischer Leistung zu ersetzen? Im Business-to-Consumer-Bereich ist es wenig realistisch, etablierten Lösungen Konkurrenz zu machen, weil der Markt hier schon fest aufgeteilt ist. Im Business-to-Business- und Business-to-Goverment-Bereich hingegen gibt es durchaus wettbewerbsfähige europäische Produkte, wie zum Beispiel Unternehmenssoftware, Software für die Digitalisierung der Verwaltung und Cloud-Lösungen. Diese bieten dabei den entscheidenden Vorteil der Europarechtstreue und Datenhoheit. Zudem zeichnen sich EU-Anbieter oft durch ihre Nischenexpertise und Branchenspezialisierung aus, wodurch ihre Lösungen insbesondere für Anwender-KMU besseren Nutzen bieten. Digitale Souveränität bedeutet in der aktuellen Lage natürlich auch massive Migrationsprojekte. Was denken Sie, was das an Kosten nach sich ziehen würde? Es wäre schon ein großer Schritt, bei ohnehin anstehenden Projekten nicht immer wieder auf Lösungen aus Übersee zu setzen oder den Großteil der heimischen Marktwirtschaft durch Technologievorgaben, wie Open Source, auszuschließen. Bei den Kosten für Migrationsprojekte empfehlen wir ein strategisches Vorgehen. Es ist weder sinnvoll noch realistisch, alles selbst zu entwickeln oder jede außereuropäische Anwendung eins zu eins zu ersetzen. Dennoch müssen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft in allen zentralen Bereichen der digitalen Transformation handlungsfähig bleiben. Dazu zählt insbesondere die digitale Infrastruktur der Verwaltung. Angesichts des hohen Digitalisierungsbedarfs sollte hier ein besonderer Fokus auf neue Vergaben gelegt werden – mit digitaler Souveränität als zentralem Auswahlkriterium. Ist komplette digitale Souveränität überhaupt realistisch? Gibt es nicht auch Bereiche, in denen sie fernes Ideal bleiben muss? Komplette digitale Souveränität ist unrealistisch und unnötig. Europa könnte aber eine Keystone-Strategie fahren, nach der wir zumindest unverzichtbare Schlüsselpositionen im digitalen Wertschöpfungsprozess weltweit besetzen. Im Bereich der Halbleiterproduktion verfügt etwa das niederländische Unternehmen ASML eine solche Position, in der Unternehmenssoftware ist es SAP, weitere könnten in vielen digitalen Nischen erobert werden – analog zu den Nischen-Weltmarktführern der letzten 70 Jahre. Gerade im B2C-Markt wäre das Ziel der kompletten digitalen Souveränität unrealistisch. Im entscheidenden B2B- und B2G-Bereich besteht jedoch die Chance, erhebliche Marktanteile zu sichern und die digitale Zukunft nach unseren eigenen Werten aktiv mitzugestalten und somit an digitaler Selbstbestimmung zu gewinnen. Es ist eine weitverbreitete Fehlannahme, dass es keine europäischen Lösungen in diesen Bereichen gibt. Natürlich dürfen die Bestrebungen nicht in Protektionismus münden. Sofern also eine gute Lösung ausschließlich aus Übersee verfügbar ist, sollte diese auch eingekauft und eingesetzt werden. Herr Grün, vielen Dank für das Interview! (axk)