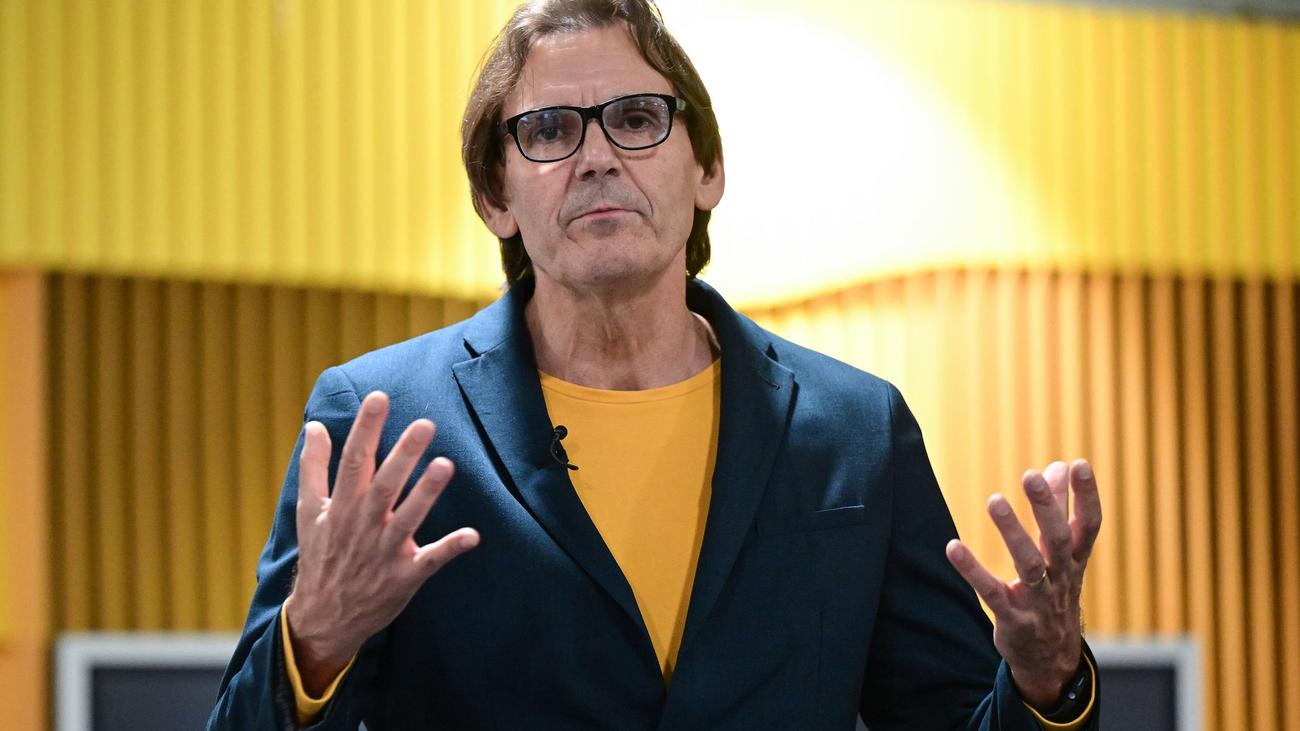RoboBee: Mikro-Schlagflügelroboter landet sicher auf Pflanzenblättern

Forscher des Harvard Microrobotics Laboratory haben einen winzigen Schlagflügelroboter nach dem Vorbild der Kranichfliege entwickelt, der mit seinem filigranen Landegestell in der Lage ist, auf Pflanzenblättern zu landen. Die RoboBee ist mit einer speziellen Landesteuerung und die Beine mit Gelenken ausgestattet, um sichere Landungen hinlegen zu können. Anzeige Die neue RoboBee, eine Weiterentwicklung der bereits mehrere Jahre alten Ursprungs-RoboBee, wiegt lediglich 0,1 g und hat eine Flügelspannweite von 3 cm. Die Flügel werden als Schlagflügel von piezoelektrischen Aktuatoren angetrieben. Das Problem bei solchen Systemen ist der bei Landungen entstehende Bodeneffekt, Luftverwirbelungen, die durch die schlagenden Flügel ausgelöst werden und zu Instabilität bei der Landung führen können. Ein Absturz bei der Landung wäre aber für den kleinen Flugroboter fatal, denn die verwendeten Aktuatoren und filigranen Flügel sind sehr empfindlich und könnten dadurch Schaden nehmen. "Wenn wir früher landen wollten, mussten wir das Flugvehikel etwas über dem Boden abschalten, es einfach fallen lassen und beten, dass es aufrecht und sicher landet", erklärt Christian Chan, ein Doktorand, der die mechanische Neukonstruktion des Flugroboters geleitet hat. Aufprallenergie mit mechanischem Landegestell und speziellem Landealgorithmus abfangen Um eine sichere Landung zu gewährleisten, schauten sich die Wissenschaftler eine biologische Kranichfliege an, wie sie in der Studie "Sticking the landing: Insect-inspired strategies for safely landing flapping-wing aerial microrobots" erläutern, die in Science Robotics erschienen ist. Diese Insekten sind in der Lage, auf verschiedensten Untergründen elegante Landungen zu vollführen. Dazu mussten die Forscher zunächst die Geschwindigkeit des Roboters bei der Annäherung an die Landefläche minimieren, um die Aufprallenergie bei der Landung schnellstmöglich abzubauen. Die Wissenschaftler nahmen sich die Beine der Kranichfliege zum Vorbild, die aus langen, gelenkigen Fortsätzen bestehen, die Landungen abdämpfen können. Die Forscher bauten das System nach, testeten verschiedene Materialien und integrierten es schließlich in ihre RoboBee. Neben den mechanischen Voraussetzungen passten die Wissenschaftler auch noch die Flugsteuerung des kleinen Flugroboters an. Dabei orientierten sie sich auch an dem Landeverhalten von Kranichfliegen, die aus einem Schwebeflug heraus beschleunigen, in Richtung Landeziel abbremsen und mit einer geringen Aufprallgeschwindigkeit aufsetzen. Die noch vorhandene Aufprallenergie nimmt dann das mechanische Landegestell auf. Die dafür nötige Steuerungssequenz und Auswertung der Sensorik ergänzten die Forscher in ihrem externen Steuerungssystem, denn die RoboBee ist noch per Kabel damit verbunden. Neben den Steuerungssignalen erhält sie darüber auch ihre Energie. So ausgerüstet, kann die RoboBee auf einer Vielzahl von Untergründen zielgenau landen – darunter auch auf Pflanzenblättern. Dabei zeigte sich die Kabelverbindung allerdings als Hindernis. Die Forscher wollen nun die RoboBee von dieser Fessel befreien und die Sensorik, Steuerung und Energieversorgung miniaturisieren, um sie direkt in den Flugroboter einbauen zu können. Dann soll die RoboBee auch autark fliegen können, um sie etwa zur künstlichen Bestäubung in der Landwirtschaft einzusetzen. Allerdings sind die Herausforderungen bei der Verkleinerung der Komponenten extrem hoch. Sie gelten bei winzigen Flugrobotern als dreifacher Heiliger Gral. Anzeige (olb)