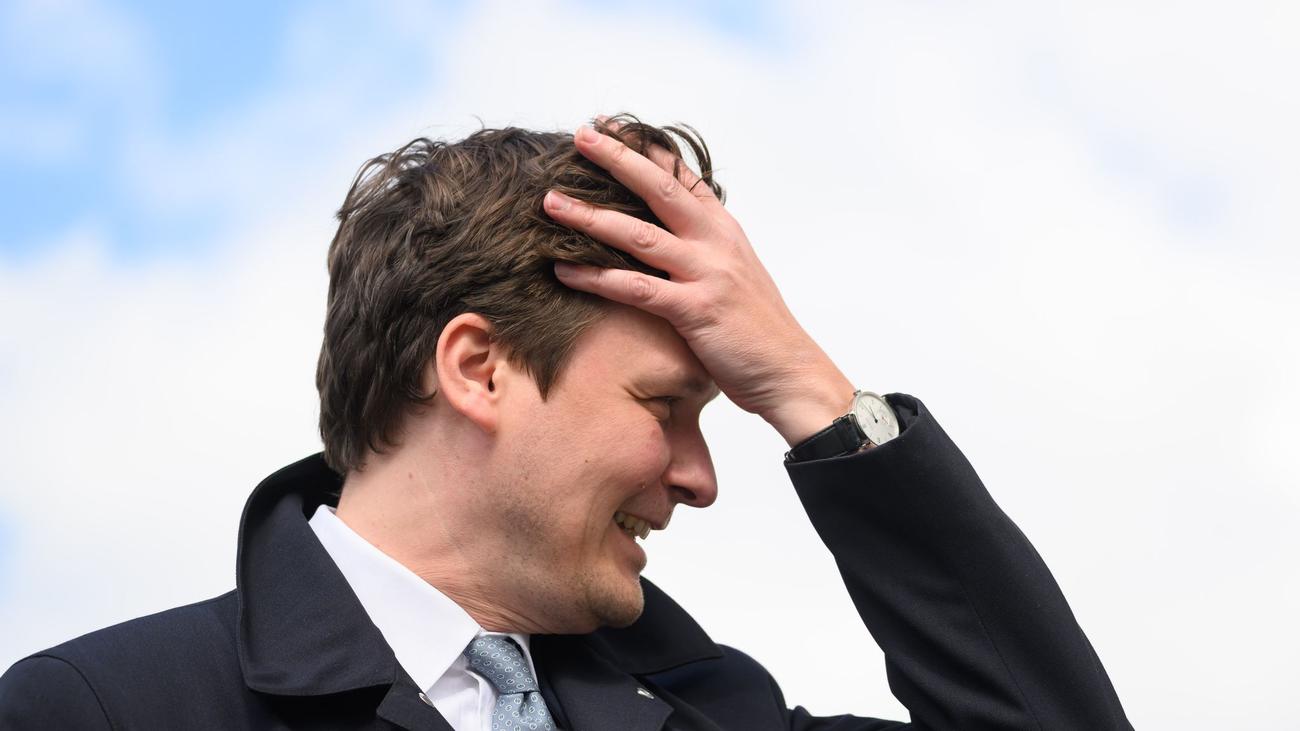Welfenschatz-Debatte: Das leere Grab und seine rätselhafte Geschichte

Das Grab ist leer. Der Deckel des Sarkophags lehnt vor dem Kasten. Rechts sitzt geradezu leger der Engel, mit leicht vornübergebeugtem Kopf. Mit der rechten Hand zeigt er auf den Spalt, der im Elfenbeinrelief die Illusion eines Hohlraums schafft. Links stehen die drei Frauen, die kugelförmigen Ölgefäße haben sie nicht aus den Händen gelegt, obwohl der Leichnam verschwunden ist, den sie salben wollten. Der Schnitzer hat sie am Rand zusammengedrängt, damit möglichst viel Raum leer bleibt. Die Wächter schlafen nicht Über dem Sargdeckel ist ein Schriftband drapiert. Die Inschrift bricht im dritten Wort ab, dessen letzter Buchstabe von der linken Hand des Engels verborgen wird: ECCE LOCUS UB. Fromme Betrachter konnten den sechsten Vers aus dem sechzehnten Kapitel des Markusevangeliums vervollständigen: Ecce locus, ubi posuerunt eum – Seht hier, der Ort, wo sie ihn abgelegt haben. Die Gruft ist eine Krypta. Oberhalb der Sargöffnungsszene hat der Künstler die Wächter postiert. Er hat sie nicht schlafend dargestellt, sondern hellwach gestikulierend. Sie blicken hinunter, und ihre spitz zulaufenden Schilde scheinen hinunter zu zeigen. So werden die Soldaten, die Pilatus laut Matthäus abstellte, weil die Hohepriester den vermeintlichen Betrüger aus Nazareth noch im Tod bekämpfen und dem Grabraub als Akt der Religionsstiftung durch Lug und Trug mit eigener List zuvorkommen wollten, in den Dienst der Verkündigung genommen: Als unverdächtige Zeugen folgen sie als Erste der Aufforderung zum Hinsehen, die sich an alle richtet, die das hier festgehaltene Geschehen zu Gesicht bekommen, ein Geschehen, das ein unmittelbar vorangegangenes, nach menschlicher Erfahrung unvorstellbares Geschehen belegen soll. Der aus dem Elfenbein herausgearbeitete Ort, auf den wir blicken, wenn wir im Berliner Kunstgewerbemuseum vor der Vitrine mit dem Kuppelreliquiar aus dem Welfenschatz stehen, ist eingemauert in einen Kirchenbau, der 45,5 Zentimeter hoch ist.