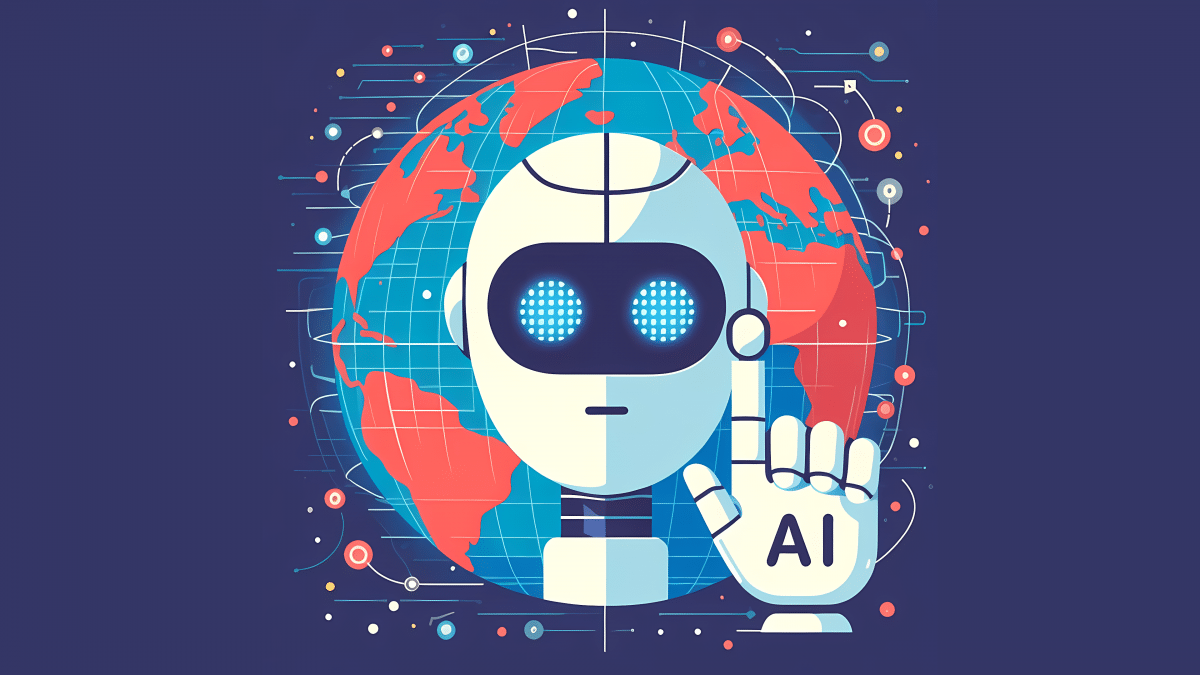Constanze Klaue: Das Leben bleibt eine Baustelle

Gerade saß man noch im Kino und sah einer sächsischen Familie dabei zu, wie sie versuchte, im neuen Gesamtdeutschland heimisch zu werden und sich etwas aufzubauen, konkret: ein Haus. Der Fortschritt auf dem Bau zeigte den beim Heimischwerden an – und ein wenig auch den des Großprojekts deutsche Einheit Anfang der Nullerjahre. Den Film noch vor Augen, wartet man nun wirklich vor genau diesem Haus, an einem Frühlingsvormittag dieses Jahres, im östlichen Berliner Umland, und denkt: Tja. Könnte besser aussehen. Ein dunkles Dach, das auf zwei helle Stockwerke drückt. Aus der Fassade quillt gelbe Dämmwolle. An der Garage verdorrt ein Hagebuttenstrauch. Der Maschendrahtzaun zur Straße ist umgeknickt, unter einem "Zu verkaufen"-Schild. "Hoffentlich sind nicht wieder die Waschbären drin", sagt Constanze Klaue, nachdem sie aus dem Auto gestiegen ist. Dann macht sie einen großen Schritt über den Zaun, an dem ein Briefkasten mit ihrem Nachnamen hängt, und bittet herein, in ihr von der Kinoleinwand so vertrautes Elternhaus. Darin spielen die beklemmenden Familienszenen von Klaues Debütfilm Mit der Faust in die Welt schlagen. Er basiert auf Lukas Rietzschels gleichnamigem Bestseller, hatte auf der Berlinale Premiere und kommt nun am 3. April in die Kinos. Der Stoff eines maßgeblichen ostdeutschen Autors also, adaptiert von einer gefragten ostdeutschen Regisseurin in einem echten Elternhaus, das im Film zu einem Prototyp wird – das ist das Setting. Ein paar Zeilen zum Inhalt, bevor es um Klaue gehen soll: Buch und Film sind Sozialstudien über die ostdeutsche Provinz und erzählen vom Rechtsdrift ihrer Bewohner im Nachwendekater. Die Filmhandlung setzt 2006 ein und endet 2015, wird also gerahmt von zwei deutschen Sommermärchen. Doch von der Freude über ein neues, weltoffenes Deutschland – und sei es nur die Freude an sich selbst – dringt wenig vor bis zu Familie Zschornack, deren Haus im Film nicht kurz vor Berlin, sondern in der Oberlausitz steht. In das Leben der Zschornacks zoomt Klaue hinein, ganz nah an ihre Gesichter: in die der Eltern Sabine und Stefan, auf denen sich Sorgenfalten wie Jahresringe ausbreiten; vor allem aber auf die meist leicht offen stehenden Münder der Söhne Philipp (der ältere, mit Zahnspange und aufgesetzter Coolness) und Tobi (hinter dessen Pausbacken womöglich die wahre Härte wartet). Wenn auch nicht alles, so erscheint am Anfang zumindest noch einiges für sie möglich. Der Rohbau steht, das Geld reicht für Kuchen mit Sprühsahne und die Liebe auch mal für ein Bussi. Doch bald kommt es, wie es kommen muss – das legt der Film einigermaßen nahe. Vatis Arbeit macht jetzt ein Pole für weniger Geld. Die Mutter radelt zu den Nachtschichten, da der Passat nicht mehr anspringt. Und die unbeaufsichtigten Kinder suchen nach Orientierung und Zugehörigkeit, oder vielleicht nur etwas Spaß, und finden beides bei einem nicht viel Stärkeren in Bomberjacke. © ZEIT ONLINE Newsletter Natürlich intelligent Künstliche Intelligenz ist die wichtigste Technologie unserer Zeit. Aber auch ein riesiger Hype. Wie man echte Durchbrüche von hohlen Versprechungen unterscheidet, lesen Sie in unserem KI-Newsletter. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Wenn Constanze Klaue nun eine Tour gibt durch die fast leeren Zimmer, dann läuft in jedem gleich eine Szene vor dem inneren Auge an aus dem Kammerspielalltag der Zschornacks: In der Küche liegt der Heimwerkervater Stefan unter der Spüle und kriegt mal wieder nichts hin – oben im Bad kommt Philipp der Weihnachtskarpfen hoch, das Ausnehmen der Innereien hat ihm auf den Magen geschlagen, dazu die Eiseskälte am Esstisch. An dieser Stelle ist ein externer Inhalt eingebunden Zum Anschauen benötigen wir Ihre Zustimmung Bitte aktivieren Sie JavaScript damit Sie diesen Inhalt anzeigen können. Weiter Eigentlich habe sie ihrem Team das Haus nur deshalb als Drehort vorgeschlagen, weil das Budget knapp gewesen sei, sagt Klaue. "Und beim Schreiben hatte ich sowieso immer genau das hier vor Augen." Sie geht durchs Wohnzimmer, in dem nur noch ein Ikea-Ohrensessel und an die Wand gelehnt die Einzelteile einer Couch stehen, und raus auf die Terrasse. Klaue deutet mitten in den wuchernden Garten und sagt: "Dort war unser Kiesberg." Mit so einem ähnlichen Schuttberg beginnt Rietzschels Romanvorlage, und das Buch habe sie "direkt reingebeamt in meine Kindheit".