Bildungspolitik: Bildungsforscher sehen Reformbedarf bei Berufsorientierung an Schulen
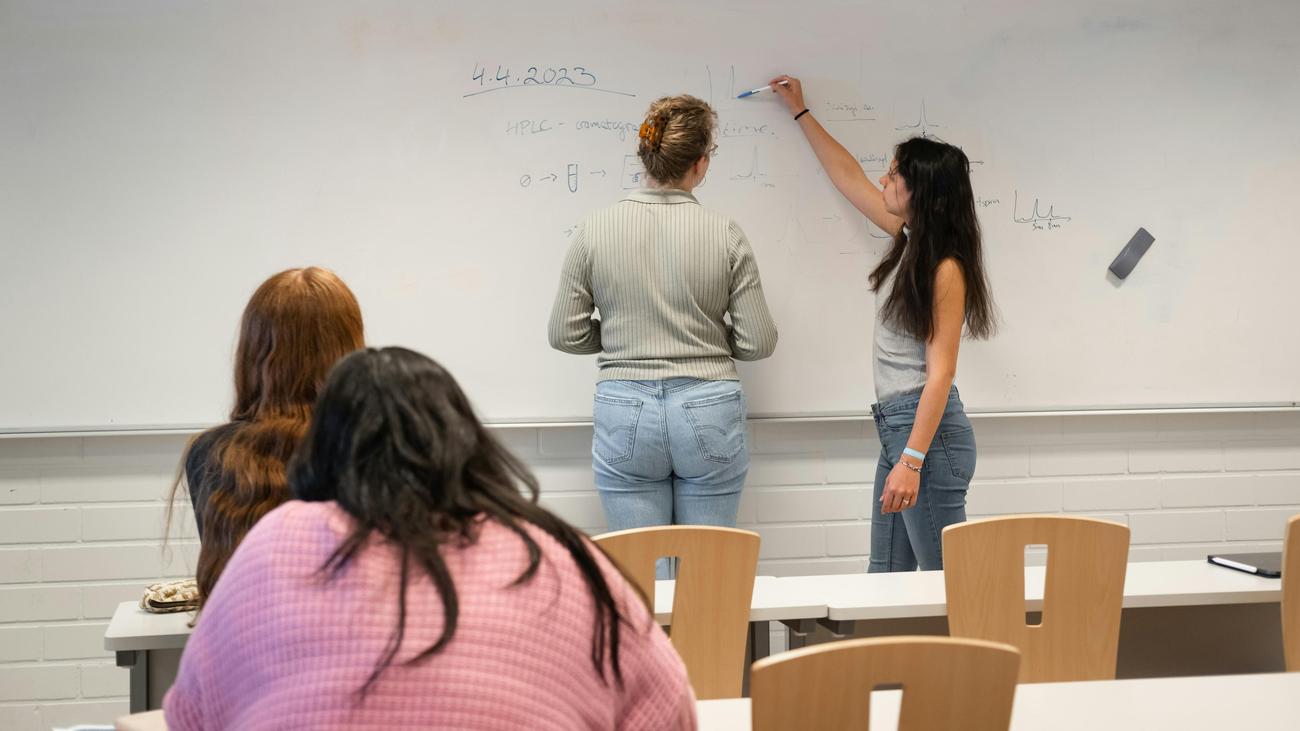
Jugendliche sollten im täglichen Unterricht besser in ihren Basiskompetenzen gefördert und professioneller in ihrer Identitätsentwicklung unterstützt werden – und das am besten so früh wie möglich. Das empfiehlt die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) der Kultusministerkonferenz. In ihrem Gutachten Kompetenzen für den erfolgreichen Übergang von der Sekundarstufe I in die berufliche Ausbildung sichern, das ZEIT ONLINE vorliegt, legt sie Empfehlungen vor für diesen Schulbereich – in der Regel die fünfte bis zehnte Klasse – und den Übergang von Schülerinnen und Schülern in eine Ausbildung. In den vergangenen Jahren seien die Anforderungen an fachliche und soziale Kompetenzen in vielen Berufen gestiegen, schreibt die SWK. Diese lernten Kinder normalerweise früh in Sozialisation und Bildung, weswegen es umso schwieriger sei, sie später zu erlernen. Zudem brauchten Unternehmen zunehmend Auszubildende, die mit der wachsenden Digitalisierung umgehen könnten. Gleichzeitig gelinge es einer Viertelmillion junger Menschen nicht, direkt eine Ausbildung zu beginnen. Nachholen von Basiskompetenzen als Voraussetzung Deswegen sei es wichtig, alle Jugendlichen so zu fördern, dass sie die Mindeststandards in fachlichen, aber auch überfachlichen Grundkompetenzen erreichten, schreibt die SWK. Denn oftmals verließen Kinder die Grundschule, ohne Basiskompetenzen wie selbstständiges Lernen, aber auch Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben und Rechnen ausreichend erlernt zu haben. Das müssten sie durch gezielte Förderung zum Beginn der Sekundarstufe I, also in der fünften und sechsten Klasse, nachholen. Dafür müssten die Bildungsministerien den Lehrkräften die Möglichkeiten schaffen, etwa durch die Umgestaltung von Lehrplänen, Tests und Abschlussprüfungen und das Verankern von Förderangeboten im Unterricht. © Lea Dohle Newsletter Was jetzt? – Der tägliche Morgenüberblick Starten Sie mit unserem kurzen Nachrichten-Newsletter in den Tag. Erhalten Sie zudem freitags den US-Sonderletter "Was jetzt, America?" sowie das digitale Magazin ZEIT am Wochenende. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Zudem ist nach Angaben der SWK die Identitätsbildung eine zentrale Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufsorientierung bei Jugendlichen. Denn in der Sekundarstufe I stellten sich Jugendliche zunehmend Fragen zu persönlichen und beruflichen Zielen. "Schule in ihrer erzieherischen Funktion muss sich dieser Entwicklungsaufgaben bewusst sein und die Jugendlichen bei der Bewältigung unterstützen", schreibt die SWK. Professionalisierung von Berufsorientierung Jugendliche sollten befähigt werden, sich selbst zu informieren und Berufswünsche zu entwickeln. Dafür sei eine pädagogische Begleitung auch durch Sozialarbeiterinnen und -arbeiter wichtig. Bisherige Berufsorientierungsprogramme sind laut SWK dafür aber wenig geeignet, weil sie nur beschränkte, veraltete und oft geschlechtsspezifische Berufswünsche förderten. Die Angebote für Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Ausbildungsplatz sind laut dem Bericht unübersichtlich organisiert und werden den individuellen Problemen der Jugendlichen häufig nicht gerecht. Der Übergangsprozess in die Ausbildung müsse deswegen erleichtert werden, wofür es vor allem professionellere Akteure brauche. Die SWK empfiehlt deswegen, die Berufsorientierung in die Lehrkräftebildung zu integrieren. Die SWK ist ein unabhängiges wissenschaftliches Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz (KMK), der 16 Bildungsforscherinnen und -forscher angehören. Sie beraten die Länder in bildungspolitischen Fragen und binden dafür auch externe Sachverständige ein. 2022 legte die SWK in einem ersten Bericht Empfehlungen für die Grundschule vor.


















