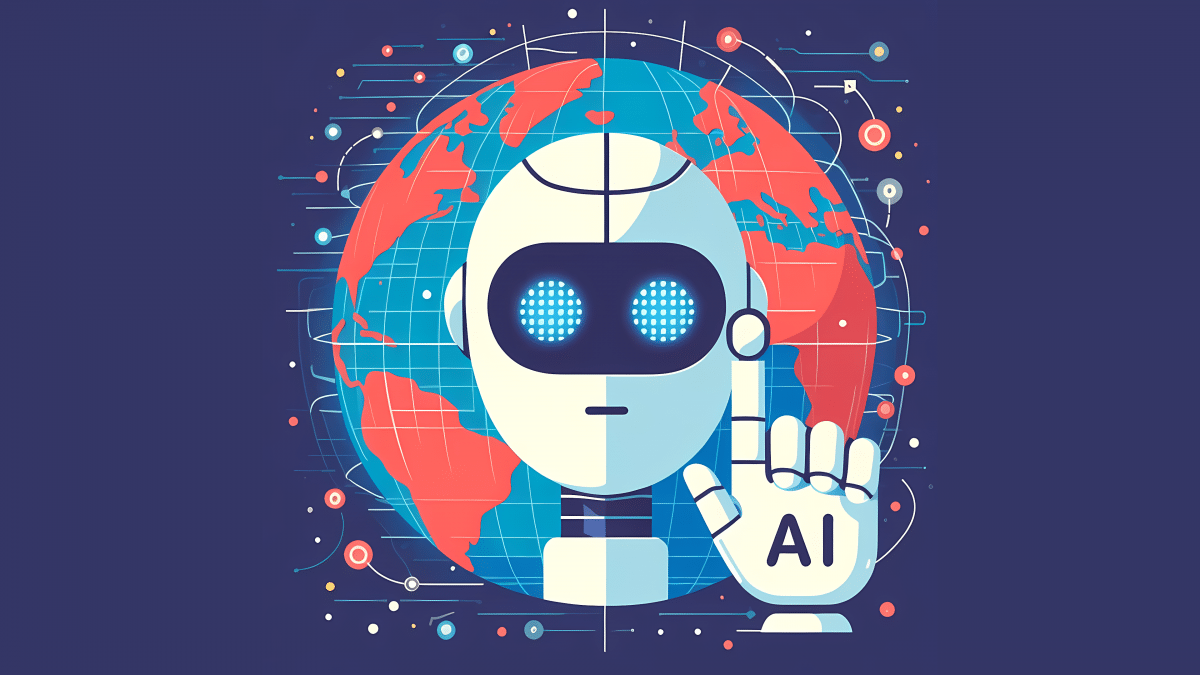Aperol Spritz: Ist der Hype vorbei?

Mit den Übergangsjacken findet ein orangefarbenes Getränk zuverlässig seinen Weg zurück auf die Tische der Innenstadt-Cafés: Aperol Spritz. Kaum ein anderer Drink hat sich in den letzten Jahren eine so treue Fangemeinde aufgebaut wie der italienische Aperitif. Die Dresdner Musikgruppe 01099 widmete ihm mit „Aperol im Glas“ einen eigenen Song. Auch Schlagersänger Vincent Gross singt: „Ich trink heut, das ist kein Witz, Aperol, Aperol, Aperol Spritz.“ Es gibt Fanartikel, wie etwa T-Shirts oder Fußmatten mit dem Aufdruck „Leben auf der Aperolspur“. Und selbst auf Weihnachtsmärkten hat sich der Drink breitgemacht – als „Hot Aperol“. Gleichzeitig gibt es seit jeher Stimmen, die ihn für „out“ erklären wollen. Schon 2019 titelte „The New York Times“: „The Aperol Spritz is Not a Good Drink“. „Muss es immer Aperol sein?“, fragte die „Süddeutsche Zeitung“ im vergangenen Jahr. „Harper’s Bazaar“ hat den Drink schon mehrmals seit Januar 2025 abgeschrieben, unter anderem mit der Überschrift: „Vergessen Sie Aperol Spritz!“ Was steckt hinter diesen beschwörenden Stimmen? Steht uns bald trotz all der popkulturellen Verwertung des Drinks ein bittersüßer Abschied bevor? Zu massentauglich für kreative Barkeeper Nein, sagt zumindest der Offenburger Gastronom Willi Schöllmann. Der Aperol sei ein gutes Produkt, und auch die Aperitivo-Kultur sei weiterhin auf dem Vormarsch. Nur kreative Barkeeper fänden den Drink zu massentauglich und deshalb etwas langweilig. Schöllmann hat mit 15 Jahren begonnen, in der Gastronomie zu arbeiten, mit 18 Jahren machte er sich selbständig. Heute betreibt der Einundfünfzigjährige in seiner Heimatstadt Offenburg mehrere Lokalitäten, darunter zwei Hotels, zwei Bars, ein Restaurant und ein Café. Seine Heimatverbundenheit zeigt sich auch in seiner Barkunst. 2006 hatte Schöllmann die Idee, klassische Cocktails mit heimischen Obstbränden zu mixen: „Es hat eine Weile gedauert, bis die Leute das kapiert haben, aber dann kam es gut an.“ Aperol ist laut Schöllmann nicht nur wegen des erfolgreichen Marketings der Firma Campari so beliebt. „Menschen trinken einfach weniger hochprozentige Spirituosen – beziehungsweise gezielter“, sagt Schöllmann. Der Aperitif als leichteres, alkoholisches Getränk habe daher in den letzten Jahren unheimlich dazugewonnen. Genau deshalb hat Schöllmann auch ein Jahr lang an einer Alternative zum Aperol getüftelt. Seine Eigenkreation namens Amerouge ist inzwischen sein Signature-Getränk. Weniger Alkoholkonsum in Deutschland Im Vergleich zum Aperol sei dieser natürlicher und habe weniger Zucker. Basierend auf Schwarzwälder Roggenbrandt, enthält der Amerouge schwarze Johannisbeeren als Fruchtgeber, die für Farbe und Geschmack sorgen, sowie getrocknete Grapefruit für die Bitterkeit und Minze für einen kräuterigen Rückton. Inzwischen lässt Schöllmann den Amerouge in einer Destillerie herstellen und verkauft ihn an andere Gastronomen und private Kunden. Externer Inhalt von Instagram Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen . Externe Inhalte aktivieren Der Aperitif-Boom spiegelt sich auch in den Zahlen des Campari-Konzerns aus dem Jahr 2024 wider. Zwar legte der Umsatz um 2,4 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zu, doch der Nettogewinn brach um 39 Prozent ein. Der Aperol war daran nicht schuld, ganz im Gegenteil: Während die Aperitifs weiterhin zulegten, schwächelten Whiskey und Rum. Schon seit vielen Jahren sinkt der Alkoholkonsum in Deutschland. Im Jahr 2020 konsumierten die Deutschen im Durchschnitt zehn Liter reinen Alkohol – sieben Prozent weniger als noch 2010. Im Vergleich zu 1985 hat sich der Konsum sogar um mehr als ein Drittel verringert. Ein Trend, der sich fortsetzen wird, wie eine Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aus dem Jahr 2022 nahelegt. Demnach verzichten immer mehr Jugendliche im Alter von zwölf bis 25 Jahren vollständig auf Alkohol – deutlich mehr als noch in früheren Generationen. „Weg vom Zucker, hin zum Frischen“ Eine, die sich für ein alkoholfreies Leben entschieden hat, ist Sommelière und Autorin Nicole Klauß. „Ich habe eigentlich noch nie Alkohol getrunken, weil ich ihn nicht vertrage“, sagt sie. „Hier mal ein Wein oder einen Averna – aber ich war immer schnell betrunken, da mein Körper den Alkohol sehr langsam abbaut.“ Früher sei die einzige alkoholfreie Alternative dann oft Saftschorle gewesen: „Die trinke ich höchstens nach dem Sport!“ Zum Glück, sagt sie, könne man heute auch trinken, ohne zu trinken. Die Autorin hat eine Weinausbildung an der Deutschen Wein- und Sommelierschule absolviert und bezeichnet sich als „Mindful Sommelière“. Das heißt, sie bietet auf ihren Veranstaltungen nur Getränke mit unter 0,5 Prozent Alkoholgehalt an. Nicole Klauß mit ihrem zweiten Buch, in dem sie die Grundlagen für die alkoholfreie Speisebegleitung erläutert. neuetrinkkultur.de Das alkoholfreie Angebot in Deutschland ist aus ihrer Sicht parallel zur steigenden Nachfrage in den vergangenen Jahren gewachsen, eigene Trends entstünden. Gerade gelte in der Branche: „Weg vom Zucker, hin zum Frischen“. Sparkling Tee, also eine prickelnde Alternative zu Schaumweinen auf Tee-Basis, stehe derzeit hoch im Kurs. Auch fermentierte Getränke, zum Beispiel mit Kombucha, Kefir oder Essig, seien gefragt. Klauß sagt: „Mit dem Alkoholfreisein kommt die Phantasie.“ „Bekömmlich für den deutschen Gaumen“ Ihre Empfehlung für einen sommerlichen Drink ohne Alkohol, den man garantiert in jedem Restaurant bekommt, ist simpel: „Einfach nach einem dunklen Saft, beispielsweise Kirsche, fragen und mit Tonic auffüllen.“ In den meisten Restaurants bekäme man inzwischen auch ohne Probleme einen alkoholfreien Aperol Spritz. Klauß ist ein großer Fan von Bitternoten: Sie nehme schon mal ein Fläschchen mit Bittertropfen ins Restaurant, um den Saft im Zweifelsfall zu pimpen – zum Unmut ihres Ehemanns, der das peinlich finde. Wo bleibt die alkoholfreie Aperol-Version von Campari? Picture Alliance Bitter und süß – das ist auch die Kombination, die dem Aperol zu so großer Beliebtheit verholfen hat. Inan Öztürk ist Barkeeper in Berlin. Er sagt, dieser Geschmack sei „bekömmlich für den deutschen Gaumen“. Es gebe aber auf jeden Fall gute und bessere Alternativen, etwa Mondino. Dieser Aperitif verbinde bitter-fruchtige Orangennoten mit würzigen Enzianaromen – „super lecker und erwachsener“, so Öztürk. Öztürk arbeitet seit dreizehn Jahren als Barkeeper, seit drei Jahren in der Velvet Bar in Berlin-Neukölln. Dort wird jede Woche die Karte geändert – basierend auf den regionalen Pflanzen, die in und um Berlin wachsen. Dafür machen er und sein Team sich auch gern mal selbst los und sammeln. „Foraging“, also Nahrungssuche, wird das genannt. Wenn andere Bars Aperol servieren, gibt es in der Velvet Bar etwa einen Drink aus Robinienblüten vom Tempelhofer Feld. Die spezielle, florale Note funktioniere wunderbar in einem sommerlichen Spritz. Auf den frühen Abend setzen Die Aperitivo-Kultur schätzt Öztürk aus einem sozialen Blickwinkel: „Die Leute wollen seit Corona nicht mehr so lange draußen unterwegs sein. Vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht aus finanziellen Gründen.“ Und genau darin sieht er das Potential des Aperitifs. Ein leichtes Getränk schon am frühen Abend, dazu einen Snack – das sei eine Chance für den sozialen Zusammenhalt. „So kommen die Leute zusammen“, sagt er. „Heute haben viele verlernt, mit Fremden zu reden.“ Externer Inhalt von Instagram Um externe Inhalte anzuzeigen, ist Ihre widerrufliche Zustimmung nötig. Dabei können personenbezogene Daten von Drittplattformen (ggf. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen . Externe Inhalte aktivieren Und an dieser Stelle könnte der Aperol als klassischer Aperitif wieder ins Spiel kommen. Campari hat eine Art Skala mit drei Stufen entwickelt: In der Expansionsphase Nummer eins wird der Aperol Spritz an sommerlichen Bar-Nachmittagen genossen. In Phase zwei gibt es Aperol das ganze Jahr lang, zum Beispiel auch in Skiresorts. In Phase drei gehört Aperol Spritz zum Mittagessen, wie etwa in Italien. Vergangenes Jahr sagte der damalige Campari-Vorstandsvorsitzende Matteo Fantacchiotti der F.A.Z., Deutschland befinde sich erst zwischen Phase zwei und drei.