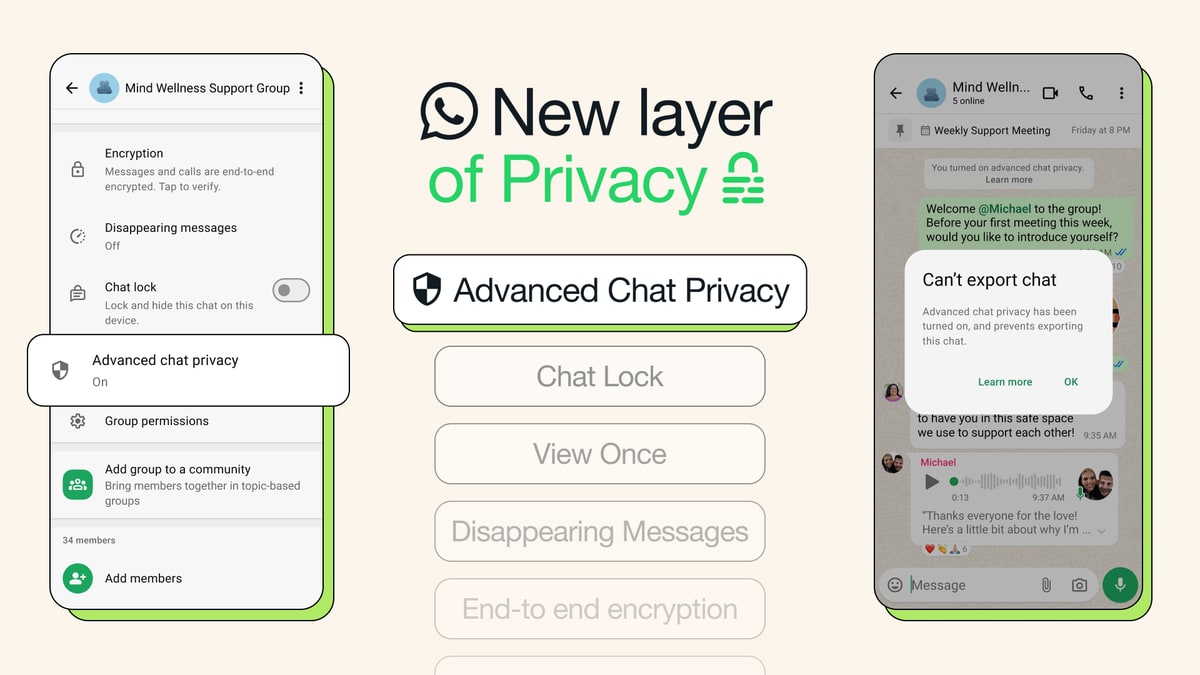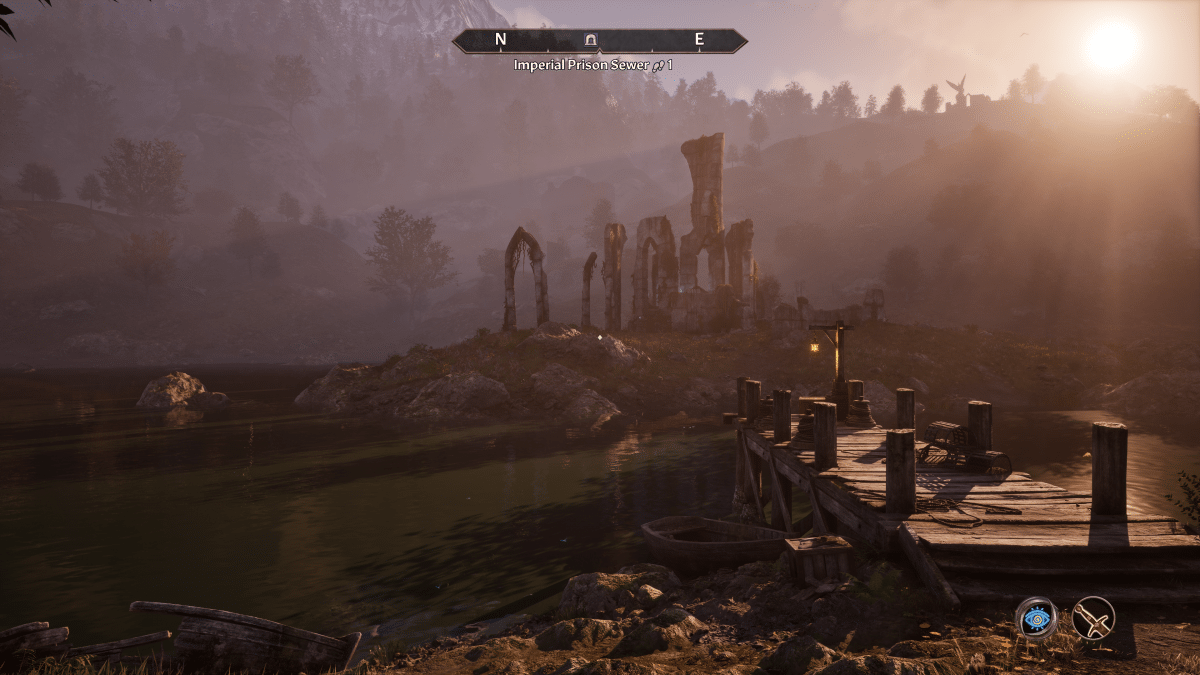EUGH bestätigt: Mobilfunkverträge maximal 24 Monate lang
Die maximale Laufzeit von Mobilfunkverträgen mit Verbrauchern beträgt 24 Monate, auch wenn es sich um eine vorzeitige Vertragsverlängerung handelt. Diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) bedeutet eine Niederlage für Vodafone Germany und einen Sieg für Verbraucherschützer. Der seit Jahren anhängige Rechtsstreit ist bereits bis zum Bundesgerichtshof und zurück zum Landgericht Düsseldorf gelaufen. Anzeige Anlass für das Verfahren sind Versuche Vodafones, deutsche Verbraucher für länger als 24 Monate zu binden. In einem Fall wollte ein Bestandskunde vor Ablauf der ursprünglichen 24 Monate ein neues, subventioniertes Handy, und willigte dafür im Jahr 2018 in einen "neuen Vertrag" zu höheren Kosten ein. Dabei unterschrieb der Verbraucher auch eine Klausel, wonach "am ersten Tag nach Ablauf der Mindestvertragsdauer des Erstvertrags eine neue Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten" beginne. Vom Zeitpunkt der Unterzeichnung gerechnet bedeutete das allerdings mehr als 24 Monate. In einem zweiten, ähnlichen Fall aus dem Jahr 2018 unterzeichnete ein deutscher Konsument zwei Monate vor Ablauf der 24 Monate des ursprünglichen Vertrages ein Dokument mit dem Titel 'Vertragsverlängerung", das eine Vertragslaufzeit von 26 Monaten festgelegte. Wiederum akzeptierte er höhere laufende Kosten und erhielt dafür ein neues Handy. Diese Praxis brachte Vodafone eine Klage der Verbraucherzentrale Berlin ein. 2018 war übrigens das Jahr, in dem Google Pixel 3 und Pixel 3 XL auf den Markt brachte. "Anfängliche Mindestvertragslaufzeit" Die damals gültige Fassung der Universaldienstrichtlinie legte eine "anfängliche Mindestvertragslaufzeit" von maximal 24 Monaten fest. Das hat der Bundestag ins deutsche Telekommunikationsgesetz übernommen. Vodafone vertrat den Standpunkt, dass einvernehmliche Vertragsverlängerungen mit Bestandskunden nicht unter den Begriff "anfänglich" fielen; die Bestimmung beziehe sich lediglich auf den allerersten, also den "anfänglich" mit einem Verbraucher geschlossenen Vertrag, nicht auf Folgeverträge. Vielleicht hatte Vodafone einen italienischen Juristen mit Ausarbeitung der Verträge betraut. Beim Landgericht Düsseldorf (LG) fand Vodafones Argument zwar Gehör, doch urteilte das Gericht aus anderen Gründen gegen den Netzbetreiber. Beide Seiten beriefen, und das Oberlandesgericht erteilte Vodafones Auslegung eine Absage. Der daraufhin bemühte Bundesgerichtshof schickte den Fall zurück an das Erstgericht, zwecks Erhebung fehlender Sachverhaltsdetails. Zuletzt lag der Fall zum zweiten Mal beim Oberlandesgericht (OLG), das zwei mögliche Auslegungen der Formulierung "anfängliche Mindestvertragslaufzeit" sah: Entweder beziehe sich das auf nur auf Erstverträge zwischen Kunden und Anbietern, oder auch auf jede weitere Mindestvertragslaufzeit. Das OLG richtete ein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH, der nun im Sinne des Wettbewerbs sowie des Verbraucherschutzes entschieden hat (Az. C-612/23). Dabei stellt das Gericht klar, dass sich "der Begriff 'anfängliche Mindestvertragslaufzeit' in (der Universaldienstrichtlinie) sowohl auf die Laufzeit des Erstvertrags zwischen einem Verbraucher und einem Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste als auch auf die Laufzeit eines Folgevertrags zwischen denselben Parteien bezieht, sodass dieser Folgevertrag keine Mindestvertragslaufzeit von mehr als 24 Monaten beinhalten darf, und zwar auch dann nicht, wenn er vor Ablauf des Erstvertrags unterzeichnet und in Vollzug gesetzt wurde." Anzeige Italienisch ist anders Zunächst hat der EuGH verschiedene Sprachfassungen der Richtlinie herangezogen. Dabei fanden die Richter heraus, dass der Wortlaut der Bestimmung in der spanischen, deutschen, griechischen, englischen und französischen Sprachfassung deutlich mache, "dass sich das in weiblicher Form verwendete Adjektiv 'anfängliche' nicht auf die 'Verträge' oder den '[V]ertrag' beziehen soll, sondern auf die 'Mindestvertragslaufzeit'." Die Befristung auf höchstens 24 Monate würde also sowohl für den Erstvertrag als auch etwaige Folgeverträge gelten. Andere Sprachfassungen wie die italienische und portugiesische könnten jedoch dahin ausgelegt werden, dass nur der Erstvertrag erfasst sei. Doch die Erwägungsgründe der Richtlinie und ihr Ziel machten deutlich, dass sie Verbrauchern erleichtern sollte, Anbieter zu wechseln, "um in den vollen Genuss der Vorteile" des Wettbewerbs zu kommen. Die aktuelle Fassung der Universaldienstrichtlinie (Richtlinie 2002/22/EG) befasst sich übrigens nicht mehr mit dem Thema Vertragslaufzeit, es ist in den Kodex für die elektronische Kommunikation (Richtlinie (EU) 2018/1972) umgezogen. Dort gibt es eine klarere Formulierung, wonach Telecom-Verträge mit Verbrauchern "keine Mindestvertragslaufzeit enthalten (dürfen), die 24 Monate überschreitet." Ausgenommen davon ist Maschine-Maschine-Kommunikation (M2M). Das deutsche Telekommunikationsgesetz sprach schon damals in Paragraph 43b von der "anfänglichen Mindestlaufzeit eines Vertrages", nicht etwa von der Mindestlaufzeit eines anfänglichen Vertrages. Heute betrifft Paragraph 56 TKG "die anfängliche Laufzeit eines Vertrages". Der Akt geht nun zurück an das Oberlandesgericht Düsseldorf, das aller Wahrscheinlichkeit nach für die Konsumentenschützer der Verbraucherzentrale Berlin und gegen Vodafone entscheiden wird. Die 2018 subventionierten Handys sind hoffentlich längst der Wiederverwertung zugeführt. (ds)