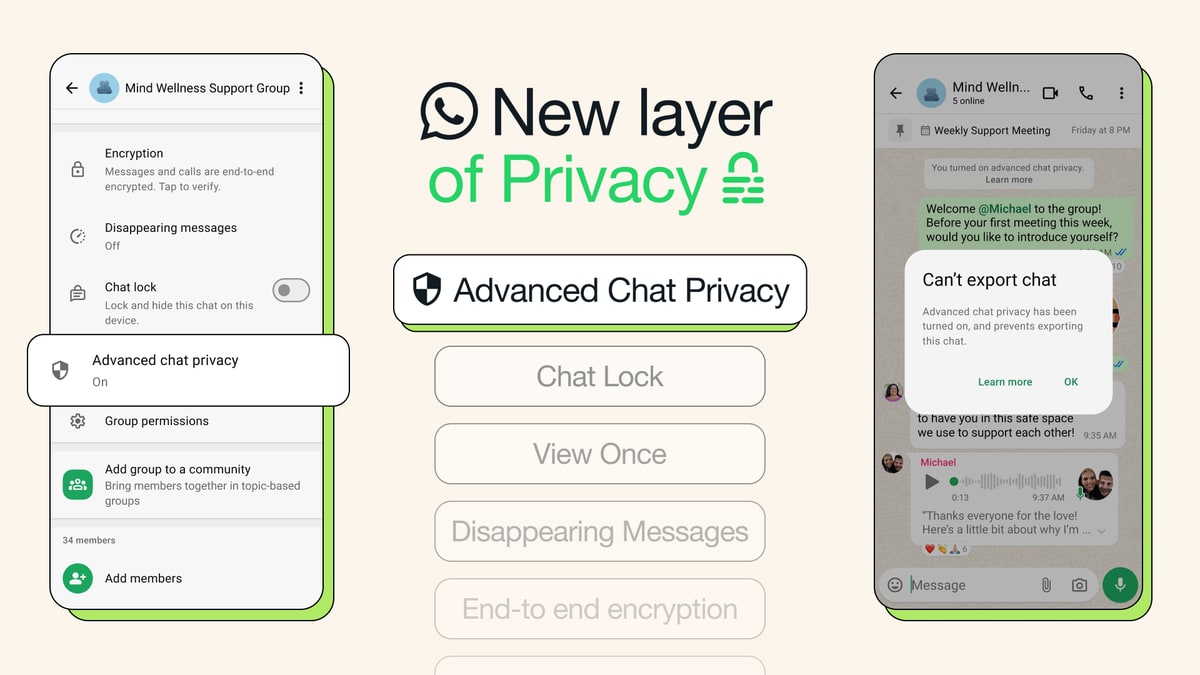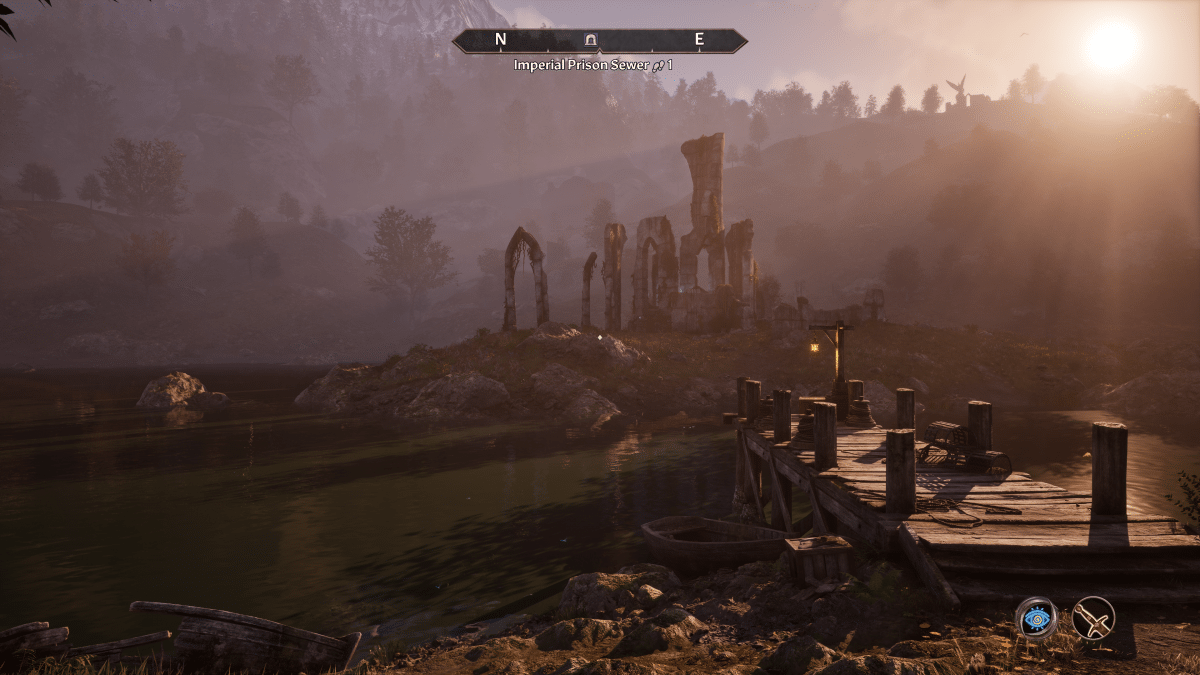Amtszeit von Papst Franziskus: War der Papst ein Modernisierer?

Michael Seewald kam 1987 in Saarbrücken zur Welt. Er lehrt als Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Universität Münster. Seewald ist zudem katholischer Geistlicher und wurde 2013 zum Priester geweiht. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat ihn mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2025 ausgezeichnet. Seewald zieht eine Bilanz der zwölfjährigen Amtszeit Franziskus. Der Papst starb am Morgen des Ostermontags. Seine letzten Worte kennen wir nicht. An die ersten Worte, mit denen Jorge Mario Bergoglio sich nach seiner Papstwahl der Öffentlichkeit vorstellte, erinnern sich hingegen viele: "Brüder und Schwestern: Buona sera!" Wer etwas Förmlicheres erwartet hatte, wurde enttäuscht. Der Neugewählte wünschte bloß einen guten Abend. Den purpurroten Überhang (Mozetta genannt) und die reich bestickte Stola, mit der seine Vorgänger auf die Loggia des Petersdoms getreten waren, hatte Franziskus nicht angelegt. In schlichtem Weiß präsentierte er sich als derjenige, den die Kardinäle vom Ende der Welt geholt haben, um Bischof von Rom und Oberhaupt von mehr als einer Milliarde Katholiken zu werden. So unscheinbar der erste Auftritt gewesen sein mag, so charakteristisch wurde er doch für die gut zwölfjährige Amtszeit des Papstes. Prunkvolle Gewänder, festliche Zeremonien und ein strenges Protokoll blieben Franziskus fremd. Weil er dadurch in Rom vieles durcheinander und in der Kirche so manchen gegen sich aufbrachte, ist ihm schnell der Ruf eines Modernisierers zugewachsen. Franziskus, so die Hoffnung der einen, werde die verkrustete Kirche in die Gegenwart führen. Der neue Papst könne gar nicht mit dem brechen, was seine Vorgänger lehrten, sondern pflege nur einen anderen Stil, so die Erwartung der anderen. Am Ende hat Franziskus beiden Gruppen recht gegeben und beide enttäuscht. Darin liegt seine größte Leistung. Franziskus kämpfte gegen Ungerechtigkeit Das nun zu Ende gegangene Pontifikat stand unter drei Leitbegriffen: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Synodalität. Hinter diesen Wörtern verbergen sich knifflige Fragen. Wie zum Beispiel ist das Verhältnis von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit? Eine Antwort lautet: Gerecht ist, wenn jeder bekommt, was ihm zusteht. Barmherzigkeit hingegen ist, wenn jemand etwas geschenkt bekommt, ganz unabhängig davon, ob er es verdient hat. Gott ist nach christlicher Überzeugung zugleich gerecht und barmherzig. Er ist gerecht, weil er denen, die Unrecht erfahren, zu ihrem Recht verhilft und auf der Seite der Schwachen steht. Gott ist aber auch barmherzig, indem er die Menschen nicht nach ihren Verdiensten beurteilt, sondern ihnen seine Liebe ohne Bedingungen schenkt. Je nach Zusammenhang hob Franziskus stärker auf die Forderung nach Gerechtigkeit ab oder mahnte zu Barmherzigkeit. Immer wieder prangerte der Papst Ungerechtigkeiten in der Verteilung von Gütern an und gab den Verlierern der globalen Wirtschaftsordnung eine Stimme. "Diese Wirtschaft tötet. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter Mann, der gezwungen ist, auf der Straße zu leben, erfriert, während eine Baisse um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht", schrieb Franziskus. Mit einer solchen Kritik, die als politisch links stehend wahrgenommen wurde, brachte er konservative Kreise, vor allem in den USA, gegen sich auf. © AFP/Getty Images Newsletter Wofür leben wir? – Der Sinn-Newsletter Jeden Freitag bekommen Sie alle Texte rund um Sinnfragen, Lebensentscheidungen und Wendepunkte. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Franziskus stand den Vereinigten Staaten nicht nur politisch und ökonomisch mit Skepsis gegenüber. Er fremdelte auch mit dem Katholizismus in diesem Land. Die amerikanischen Bischöfe hatten sich nach Meinung des Papstes zu sehr auf einige wenige Punkte eingeschossen: gegen Abtreibung, gegen Homosexualität und gegen alles, was mit Genderfragen auch nur entfernt zu tun hat. Die Mobilmachung gegen solche Themen verbindet den amerikanischen Katholizismus mit dem politischen Konservatismus, der seit der ersten Präsidentschaft Donald Trumps in einen schwindelerregenden Rechtsdrall geraten ist. Derartige Verhärtungen versuchte Franziskus zu lösen, indem er Barmherzigkeit in den Mittelpunkt stellte. Gut zwei Monate vor seinem Tod wandte er sich noch in einem Brief an die US-amerikanischen Bischöfe. Der Papst sah das, was derzeit in den USA geschieht, als "große Krise" und versuchte, die amerikanischen Bischöfe zum Widerspruch zu bewegen. "Das richtig gebildete Gewissen kommt nicht umhin, ein kritisches Urteil zu fällen und Widerspruch anzumelden gegen jede Maßnahme, die stillschweigend oder ausdrücklich den illegalen Status einiger Migranten mit Kriminalität gleichsetzt", schrieb Franziskus. Auch innerkirchlich setzte er auf Barmherzigkeit. In Abgrenzung zu einer rigiden Moral, an der auch Menschen verzweifeln, die sich als tiefgläubig betrachten (seien es nun Geschiedene, gleichgeschlechtlich Liebende oder Eheleute, die künstliche Verhütungsmittel nutzen), wollte Franziskus die Kirche zu einem "Lazarett" umbauen. Anstatt die Menschen durch Androhung von Sanktionen, wie den Ausschluss vom Empfang der Sakramente, unter Druck zu setzen, sei es Aufgabe der Kirche, die vom Leben Geschlagenen und Gebeutelten zu verarzten. Ein Leben, das nicht dem kirchlichen Ideal folgt, war für Franziskus nicht notwendigerweise Ausdruck des Unglaubens. Im Gegenteil: Dort, wo es nicht nach Plan läuft, schien ihm das Evangelium am lebendigsten. "Mir ist eine 'verbeulte' Kirche, die verletzt und beschmutzt ist, weil sie auf die Straßen hinausgegangen ist, lieber als eine Kirche, die aufgrund ihrer Verschlossenheit und ihrer Bequemlichkeit, sich an die eigenen Sicherheiten zu klammern, krank ist. Ich will keine Kirche, die darum besorgt ist, der Mittelpunkt zu sein, und schließlich in einer Anhäufung von fixen Ideen und Streitigkeiten verstrickt ist", ließ Franziskus die Priester wissen. So etwas klingt nach einem Willen zur grundlegenden Reform der Kirche. Das dachte sich zumindest eine Mehrheit der deutschen Bischöfe – und ist damit bei Franziskus abgeblitzt. Denn der Papst fremdelte nicht nur mit dem Katholizismus in den USA und dessen traditionalistischen Tendenzen, sondern er stand auch der katholischen Kirche in Deutschland und ihren Reformplänen skeptisch gegenüber. Aus Sicht des Papstes erschien die Kirche in Deutschland reich und prinzipienreiterisch, zugleich aber träge und glaubensschwach. Der Synodale Weg, mit dem die Deutsche Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken ab 2019 Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal ziehen und die Kirche reformieren wollten, wurde in Rom ausgebremst. Die Schockwellen des Missbrauchsskandals weltweit erreichten jedoch auch den Vatikan. Nachdem das Thema lange auch von ihm selbst verharmlost und den Opfern Gerechtigkeit verweigert wurde, erließ Franziskus mehrfach strengere Regeln zur Prävention von sexualisierter Gewalt, zur Bestrafung von Tätern und zur Amtsenthebung von Vertuschern. So bestellte der Papst zum Beispiel alle Bischöfe Chiles ein. Weil er den Eindruck hatte, dass ein Großteil von ihnen nicht angemessen mit dem Problem sexuellen Missbrauchs umgegangen war, zwang er die gesamte chilenische Bischofskonferenz, ihren Rücktritt einzureichen. Das betraf mehr als 30 Bischöfe, ein kirchengeschichtlich beispielloser Schritt.