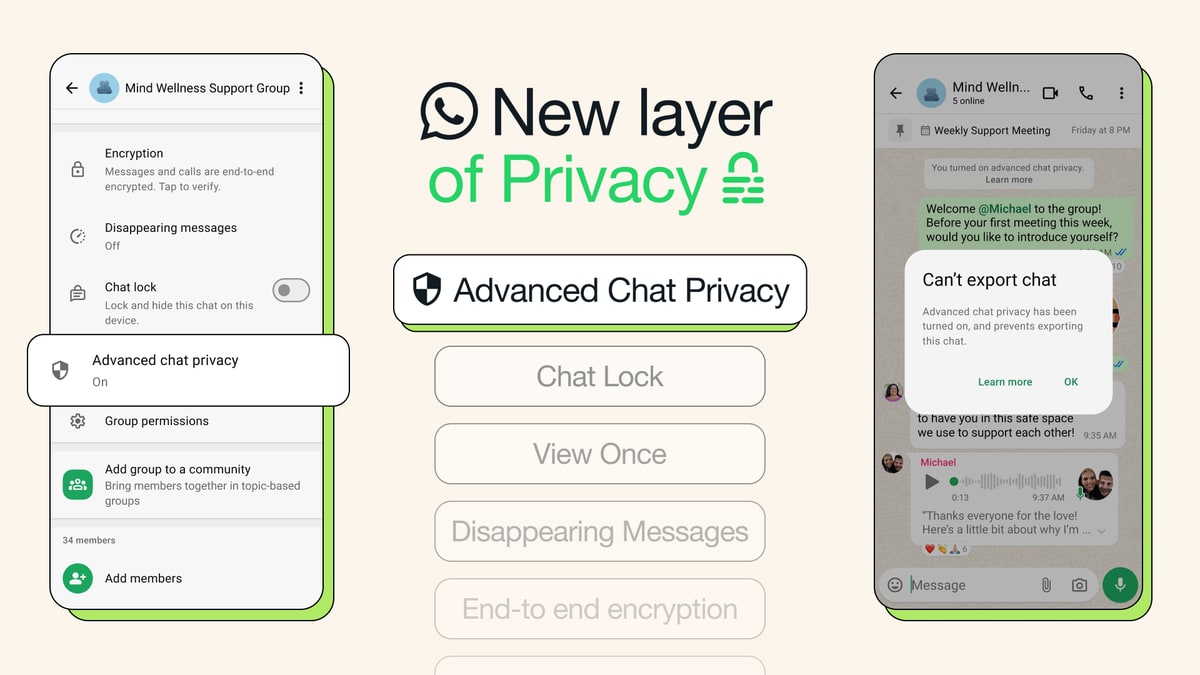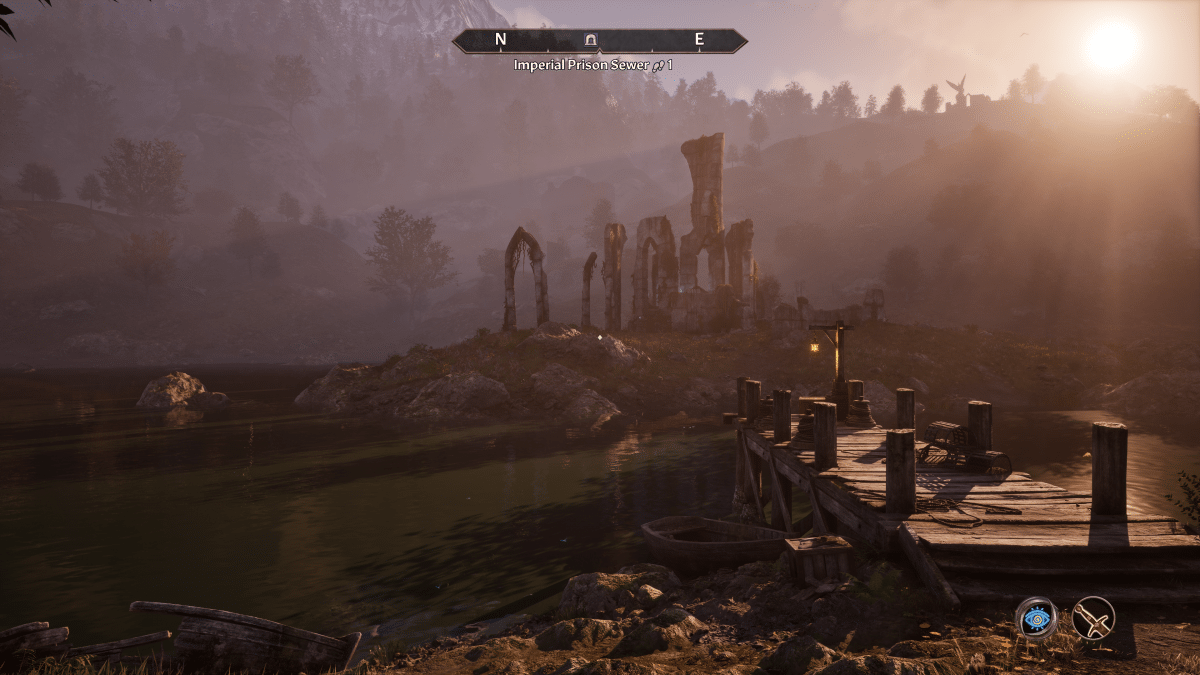Gesundheits-IT: Verbandschefin für Einbezug aller Beteiligten & bessere Planung

Am 29. April 2025 soll in Deutschland mit der elektronischen Patientenakte eine neue Ära der digitalen Gesundheitsversorgung beginnen – trotz erheblicher IT-Sicherheitsbedenken. Für die rund 70 Millionen gesetzlich Versicherten, die der ePA nicht widersprochen haben, wurde bereits eine ePA-Akte angelegt. Nun sollen diese Akten nun automatisch deutschlandweit befüllt werden. Ab dem 1. Oktober werden Ärzte dazu verpflichtet und ab Beginn des kommenden Jahres sogar bestraft, sofern sie die ePA nicht befüllen. Anzeige In der Vergangenheit hatte der Bundesverband Gesundheits-IT (bvitg) immer wieder eine realistische Zeitplanung für die Umsetzung der Software für die elektronische Patientenakte gefordert und zuletzt angemerkt, dass es noch Herausforderungen bei der ePA-Infrastruktur gibt – etwa sich unterschiedlich verhaltene Aktensysteme. Der Verband wünscht sich eine "lösungsorientierte Zusammenarbeit ohne Schuldzuweisungen an einzelne Projektbeteiligte zwischen den Leistungserbringenden in der Versorgung, der Politik, der Selbstverwaltung und der Industrie". Über die ePA, Hoffnungen und wie IT-Projekte im Gesundheitswesen künftig starten sollten, haben wir mit der bvitg-Geschäftsführerin Melanie Wendling gesprochen. Melanie Wendling ist seit August 2022 Geschäftsführerin des bvitg und davor als Abteilungsleiterin Gesundheit und Rehabilitation bei der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung tätig. (Bild: bvitg) Was bedeutet der neue Starttermin für die elektronische Patientenakte? Wir haben immer dafür plädiert, dass man das "smooth" macht, um kontinuierlich zu prüfen: Wie viel verträgt die Telematikinfrastruktur, wie geht es weiter? Was wünschen Sie sich denn von einer neuen Regierung? Eine Kontinuität in den Digitalisierungsbemühungen wäre wünschenswert. Die Digitalisierungsstrategie war ein erster Aufschlag, daran muss weitergearbeitet werden. Alle Beteiligten müssen eingebunden werden und dazu gehört eben auch die Industrie. Es geht nicht, dass wir zum Schluss einbezogen und vor vollendete Tatsachen gestellt werden, nach dem Motto: Wir haben uns etwas überlegt, jetzt setzt das mal um. Anzeige Es braucht einen Plan darüber, was wann erledigt werden muss. Es gibt wie überall in der Branche Fachkräftemangel, wodurch ein wahnsinniger Arbeitsdruck entsteht. Eine neue Regierung sollte sich hinsetzen und überlegen: Was wollen wir zu welchem Zeitpunkt – und dann auch verlässliche und umsetzbare Zeitpläne erstellen. Das ist wesentlich sinnvoller als alles gleichzeitig zu machen. Dann hakt es an allen Ecken und Enden. Hilft da das Gesundheits-Digital-Agentur-Gesetz (GDAG), das es nicht mehr geschafft hat? Was mit dem GDAG passiert, ist eine gute Frage. Das GDAG in seiner Zielrichtung war ein gutes Gesetz. Wir haben als Industrie auch immer ein KIG gefordert, also das Kompetenzzentrum für Interoperabilität im Gesundheitswesen. Wir halten das auch immer noch für richtig, nur dann bitte mit Vorgaben für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Und wichtig: Der freie Markt sollte beibehalten werden. Wir gestalten gerne mit, das haben wir in den vergangenen zwei Jahren bereits aktiv gemacht. Der bvitg ist kein Verhinderer. Wir möchten aktiv mit Vorschlägen mitgestalten. Wir wissen auch, dass das deutsche System sehr behäbig ist und sich viele Player daran beteiligen. Wir müssen besser miteinander zusammenarbeiten und die Zusammenarbeit ist auch bereits besser geworden. Aber die Industrie ist kein Gesellschafter der Gematik, daher sind wir darauf angewiesen, dass es eine Gematik gibt, die mit uns redet. Denn die Industrie hat eine Expertise, die eben nicht in der Gematik, oder in der KBV, oder in der DKG vorhanden ist. Und bei allem, was jetzt noch kommt, ist es für uns wichtig, dass es eine Art Roadmap gibt. Wann soll was in der Fläche ankommen? Nur so gibt es Planungssicherheit. Es wird öfter mal gesagt: Die Industrie hat es nicht hinbekommen, deswegen wird die Gematik jetzt wieder Behörde. Wie schätzen Sie das ein? Den mehrheitlichen Anteil an der Gematik hatte das BMG erst unter dem ehemaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Vorher war die Thematik in der Selbstverwaltung verankert. Und was hätte die Industrie denn hinbekommen sollen? Jeder hat irgendetwas gemacht – so funktioniert das nicht. Wenn es keine Spielregeln gibt, dann spielt jeder, wie er will. Deswegen sind wir als Industrie froh, dass es jetzt das KIG gibt, das einheitliche Standards machen soll. Werden sich alle bisherigen Probleme mit der Telematikinfrastruktur 2.0 in Luft auflösen? Die wenigsten Probleme lösen sich in Luft auf. Wichtig ist, dass Problemfelder transparent und offen benannt und diskutiert werden, sonst wird es schwer, Lösungswege zu finden. Gibt es Komponenten, die aus staatlicher Hand kommen sollten? Ich denke, es ist wichtig, ein gutes, gesundes Mittelmaß zwischen Regulatorik und freiem Wettbewerb zu finden. Auch beim Thema KI müssen wir wissen, wie man das reguliert – speziell mit Blick auf amerikanische Unternehmen. Es ist wichtig, dass wir da regulieren. Wir müssen aber gleichzeitig schnell sein. Unser beliebtestes Beispiel ist immer die Datenschutz-Grundverordnung. Diese gilt europaweit. Warum können Dänemark oder Frankreich Sachen, die wir nicht können? Weil sie anders ausgelegt wird. Und das darf einfach nicht sein. Europa ist nur stark, wenn wir einheitliche Regelungen in einem starken Markt haben. Die Datenschützer arbeiten da aber auch dran... Ja, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass sowohl die neue Bundesdatenschützerin, Prof. Specht-Riemenschneider, als auch die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie, Frau Plattner, doch einen sehr pragmatischen Ansatz verfolgen. Und ich glaube, das tut Deutschland sehr gut. Es gibt viele europäische KI-Anbieter und auch viele Systeme wollen KI integrieren. Wir dürfen das nicht verteufeln, schnell sein und sagen: Wir haben hier unsere europäischen Vorgaben mit europäischen Unternehmen und die zertifizieren wir. Wenn sich erst einmal Lösungen etabliert haben, dann ist es immer schwer, wieder davon wegzukommen. Fast jeder hat bereits ChatGPT genutzt und die wenigsten sind sich darüber im Klaren, dass man ChatGPT nicht vertrauen kann. Viele jüngere Menschen in meinem Umfeld googeln nicht mehr, die fragen ChatGPT. Es ist kinderleicht. Aber wir müssen uns überlegen: Wollen wir das so, wie es im Moment ist? Oder wollen wir es regulieren? Digital Health abonnieren Digital Health abonnieren Alle 14 Tage bieten wir Ihnen eine Übersicht der neuesten Entwicklungen in der Digitalisierung des Gesundheitswesens und beleuchten deren Auswirkungen. E-Mail-Adresse Jetzt anmelden Ausführliche Informationen zum Versandverfahren und zu Ihren Widerrufsmöglichkeiten erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. (mack)