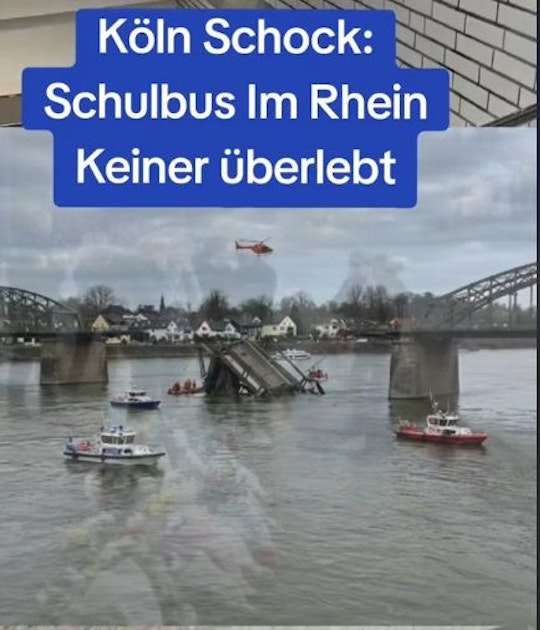„Alle wollen Care-Arbeit, niemand will dafür bezahlen“

„Alle wollen Care-Arbeit, aber niemand will dafür bezahlen“ Von: Anna Laura Müller Drucken Teilen Die dänische Autorin Emma Holten spricht im Interview über Fürsorge als Grundstein für ein funktionierendes Wirtschaftssystem, über Werte ohne Preisangaben und wieso es nicht glücklich macht, wenn sich alle wie Männer verhalten. Sich um die eigenen Kinder kümmern oder die Pflege von Angehörigen übernehmen: Unbezahlte Care-Arbeit bleibt oft an Frauen hängen. Gleichzeitig gilt sie als großer Faktor, wieso Frauen nicht genauso viele Stunden in einem bezahlten Arbeitsverhältnis verbringen wie ihre männlichen Kollegen. Die Politikberaterin Emma Holten erkennt darin eine geringe Wertschätzung für Fürsorgearbeit, die sich in unserem Wirtschaftsverständnis widerspiegelt. Frau Holten, ich würde gerne mit einem Gedankenexperiment beginnen: Was denken Sie, würde passieren, wenn Frauen ihre unbezahlte Care-Arbeit einen Tag lang niederlegen würden? Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Gesellschaft zusammenbrechen würde. Es würde Chaos auf den Straßen herrschen. Kinder, die nachmittags herumlaufen und nicht von der Schule oder der Tagesstätte abgeholt werden. In Mexiko zum Beispiel hat es tatsächlich einen solchen Streik gegeben. Deutschland sollte das auch tun. Was würde das bringen? Es würde zeigen, dass hinter jeder bezahlten Stunde viele unbezahlte Stunden stehen. Jede Person, die in einer Bank oder in einer Marketingagentur arbeitet, könnte das nicht tun, wenn es nicht so viele Hilfe gäbe. Auch wertvoll: in der Hängematte ausruhen und Zeit mit Kindern verbringen. © Ashley Corbin-Teich/Imago Care-Arbeit ist Grundlage für das Wirtschaftssystem – aber wird am wenigsten bezahlt Die Care-Arbeit ist also ein wesentlicher Bestandteil unseres gesamten Wirtschaftssystems? Die Fürsorgearbeit ist sowohl das Wertvollste als auch das am wenigsten Wertgeschätzte. Sie ist die Grundlage dafür, dass alles funktioniert, aber wir halten es für selbstverständlich, dass sie erledigt wird. Das ist eine sehr komplexe Situation, in der sich vor allem viele Frauen, aber auch Männer, befinden: Das, was am zentralsten ist, ist das, wofür man am wenigsten Zeit hat und am wenigsten bezahlt wird. Denn es gibt kein Preisschild, das wir darauf kleben können? Wenn wir über Wirtschaft sprechen, sprechen wir meistens über die Dinge, die verkauft werden und einen Preis haben, aber das ergibt ein verzerrtes Bild der Realität. Wenn Politiker zum Beispiel sagen, dass Frauen mehr arbeiten sollen, so wie es Männer tun, dann deshalb, weil sie ein Bild der Wirtschaft vor Augen haben, in dem Frauen scheinbar mehr Freizeit haben und weniger Zeit für die Wertschöpfung in Lohnarbeit aufwenden. Aber man muss berücksichtigen, womit Frauen tatsächlich ihre Zeit verbringen. Einkommen von Frauen sinkt um 60 Prozent, wenn sie ihr erstes Kind bekommen Womit denn? Man sieht sehr deutlich, dass der Grund, warum Frauen nicht so viel arbeiten wie Männer, an den Kindern liegt. Deutschland hat die höchste „Motherhood-Penalty“ (dt. Mutterschaftsstrafe) in ganz Europa. Das Einkommen von Frauen sinkt um 60 Prozent, wenn sie ihr erstes Kind bekommen. Das ist ein enormer Rückgang. Es zeigt, dass man ein Bild von der Welt bekommt, das nicht der Realität entspricht, wenn man nur Lohnarbeit als Wertschöpfung betrachtet und nicht berücksichtigt, was passiert, wenn die Menschen nicht bezahlt arbeiten. Die Art und Weise, wie wir die Wirtschaft betrachten, sollte dem echten Leben der Menschen entsprechen. Und für echte Menschen sind der Preis und der Markt nicht der einzige Ort, an dem sie gebraucht werden und wo sie Wertvolles schaffen. Was meinen Sie damit? Wenn wir mit Kindern zusammen sind, schaffen wir etwas Wertvolles, auch wenn wir nicht bezahlt werden. Wenn wir uns ausruhen, schaffen wir Wert. Wenn wir mit Freunden zusammen sind, ist das wertvoll. Wenn wir aber, wie es ein Großteil der Wirtschaft und Politik tut, den Preis als Wert ansehen, verlieren wir vieles von dem aus den Augen, was das Leben lebenswert macht. Ich plädiere also dafür, weniger zu zählen und mehr zu beobachten und zu verstehen. In Ihrem Buch ziehen Sie einen Vergleich zwischen dem Wert der Natur und der Fürsorge. Dieser Vergleich könnte für viele Menschen intuitiv Sinn machen, besonders für diejenigen, die selbst keine Kinder haben. „Natürliche Ressourcen“, wie es in den Wirtschaftswissenschaften genannt wird, wie ein Baum oder der Ozean, erleiden ein ähnliches Schicksal wie unbezahlte Care-Arbeit: Nämlich, dass wir ihnen ständig Wert entziehen, aber nichts zurückgeben. Für mich gibt es keinen großen Unterschied zwischen einem Menschen, der erschöpft ist, und einem Ozean, der erschöpft ist. Was wir beobachten können, ist, dass die Bereiche in der Wirtschaft, die keinen Preis haben, unterdrückt, missbraucht und ausgebeutet werden. Es wird so dargestellt, dass wir erst etwas wertschöpfen, wenn wir aufhören, uns selbst um unsere Kinder zu kümmern, um arbeiten zu gehen. Oder wenn wir einen Baum abholzen, um daraus eine Sitzbank zu machen. Das passiert, weil wir nicht benennen können, was wir verlieren, wenn es keinen Preis hat. Emma Holten: „Unter Wert. Warum Care-Arbeit seit Jahrhunderten nicht zählt“, übersetzt von Marieke Heimburger, dtv, 2025, 288 S., 22 Euro. © dtv Verlag Was verlieren wir denn? Wenn zum Beispiel die deutsche Regierung jetzt sagt, wir müssen die Wirtschaft ankurbeln, dann sollten wir fragen, was bedeutet das genau? Auf welche Kosten? Wenn wirtschaftliches Wachstum mehr Konsum und gleichzeitig weniger Zeit mit unseren Kindern, weniger Zeit für ein Bier mit Freunden, weniger Zeit zum Ausruhen bedeutet, werden wir dann tatsächlich reicher? In dieser Logik sehen wir den Kauf einer Handtasche als wertschöpfend an, aber ein Nickerchen zu machen ist es nicht. Und ich denke, das ist ein großer Fehler. Der Preis einer Sache ist also kein sinnvolles Mittel, um dessen Wert zu ermitteln? Das ist es, was mich am meisten stört: Wenn wir über Preise sprechen und diese Zahlen sehen, betrachten wir sie als neutrale Informationen. Wir denken, dass Zahlen nicht lügen. Aber Zahlen lügen ständig. Was Wert hat und was nicht, ist vielmehr eine politische Frage. Wie das BIP, das Sie als Maß für erfolgreiches Wirtschaften für fragwürdig halten? Es wird nie eine Zahl geben, die eine Sache oder eine Dienstleistung perfekt zusammenfassen kann. Wir müssen den ganzen Verlauf betrachten. Wofür nutzen Menschen ein Produkt? Wie wird es geschaffen? Was sind dessen langfristigen Auswirkungen? Aber stattdessen führen wir die Gesellschaft wie ein Unternehmen und schauen nur auf kurzfristige Einnahmen und Ertrag. Schauen wir uns jemanden an, der einen Baum erhalten will, und jemanden, der will, dass der Baum zu einer Sitzbank wird - dann sind das beides valide politische Meinungen. Der Unterschied besteht darin, dass in der etablierten Ökonomie die aus dem Baum gefertigte Bank als neutrales Gut angesehen, die Erhaltung und der Schutz des Baumes aber als politisch wahrgenommen wird. Aber ich bin überzeugt davon, dass letztlich beide Entscheidungen politisch sind. Besonders der Feminismus, der von weißen Frauen dominiert wird, hat sich lange nur auf unbezahlte Care-Arbeit fokussiert. Wie kommt die bezahlte Care-Arbeit ins Spiel? Im Mainstream-Feminismus galt lange das Verständnis, das Ziel sei es, dass Frauen das tun, was Männer tun. Dass Frauen die Erde so missbrauchen wie Männer es tun, dass sie arbeiten und in Aktien investieren, dass sie an der Spitze eines großen Unternehmens stehen. Aber Lohnarbeit kann auch ausbeuterisch sein. Viele der ärmsten Frauen arbeiten in bezahlten Pflegeberufen. Sie kümmern sich um die Kinder, während deren Mütter auf der Arbeit sind, sie arbeiten im Krankenhaus und pflegen deren alternde Eltern. Die Last wird also nur verlagert. Lange Zeit gab es eine Art heilige, oder besser gesagt, unheilige Allianz zwischen Feminismus und Wirtschaft. Seit den 1960er Jahren wollten alle, dass Frauen arbeiten. Die Ökonomen für die Produktivität und die Feministinnen für die Unabhängigkeit der Frauen, die natürlich enorm wichtig ist. Aber ich glaube, wir haben vor allem die Frage aus den Augen verloren: Wie glücklich sind diese arbeitenden Männer? Ist ihr Leben besser als das Leben der Frauen, nur weil sie reicher sind? Und die zweite Frage ist natürlich, was für eine Gesellschaft entsteht, wenn sich alle wie Männer verhalten. Und was mit all der Care-Arbeit passiert, die ja immer noch zu leisten ist… Ich glaube, manchmal wird sie einfach nicht geleistet. Wir haben in Dänemark eine extreme Zunahme der Einsamkeit bei älteren Menschen festgestellt. Sie sterben alleine in ihrem Zuhause. Und dann passiert es oft, dass man billige Arbeitskräfte aus dem globalen Süden importiert. Man nimmt also eine noch weniger wertvolle Frau, die kostengünstigste Frau, die man finden kann und lässt sie die Care-Arbeit machen. Die Idee, Pflegekräfte zu importieren, zeigt, dass es in der Gesellschaft einen Bedarf an kostengünstigen Frauen gibt, die diese sehr komplexe und schwierige bezahlte und unbezahlte Arbeit verrichten können. Und wenn weiße Frauen diese Arbeit nicht mehr machen wollen, dann importiert man Schwarze Frauen und Frauen of Color, die diese Arbeit machen. Es ist ein Kreislauf der Abwertung – kulturell und wirtschaftlich. Identitätspolitik und Wirtschaftspolitik lassen sich nicht voneinander trennen Unsere Konstruktion von Geschlechterrollen, Race und Klasse wirkt sich also letztlich auch auf unsere Wirtschaft aus? Ich denke, das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Wir haben die Vorstellung, dass es eine Identitätspolitik und eine Wirtschaftspolitik gibt. Aber man kann diese beiden Bereiche nicht voneinander trennen. Die Art und Weise, wie wir die Gesellschaft strukturieren, die Familien, die Beziehungen, das Wohnen, all diese Dinge haben mit Wirtschaft zu tun. Und hier stimme ich vielleicht am wenigsten mit den Ökonominnen und Ökonomen überein, denn ich denke, dass der Preis viel mit der Kultur zu tun hat. Wenn wir behaupten, dass Fürsorgearbeit einfach ist und dass sie für Frauen natürlich ist, behaupten wir gleichzeitig, dass sie nicht professionell ist. Und das trägt zur wirtschaftlichen Abwertung, den niedrigen Löhnen und schwierigen Arbeitsbedingungen bei. Bezahlte und unbezahlte Fürsorge leidet im Moment, weil wir keine geeignete Sprache dafür haben, welchen Wert sie schafft. Wir erhalten diese Fürsorge sehr billig und nehmen sie als selbstverständlich hin. Emma Holten ist Aktivistin und Politikberaterin und lebt in Kopenhagen. Sie ist Mitglied im Sachverständigenforum des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich vor allem mit Fragen der feministischen Ökonomie. © Claudia Vega Und was ist mit den Frauen, die beschließen oder nicht in der Lage sind, Mütter zu sein? Können sie sich einfach zurücklehnen und entspannen? Die Statistiken sagen, dass sie glücklicher sind als andere Menschen. Aber auch Frauen, die keine Kinder haben, werden gesellschaftlich bestraft. Vor allem jetzt, wo die westliche Gesellschaft in einer Krise von sinkenden Geburtenraten steckt. In den USA meint ein JD Vance, dass linke Frauen „childless cat ladies“ (dt. kinderlose Katzenfrauen) sind. In Dänemark haben zwei junge Politiker gesagt, dass Frauen, die keine Kinder haben, Staatsverräterinnen sind. Es scheint, dass Frauen bestraft werden, egal was sie tun. Das ist sozusagen das zentrale Paradoxon der Care-Arbeit: Alle wollen sie, aber niemand will dafür bezahlen. Und sie leisten? Natürlich ist Fürsorgearbeit schwierig und kann eine Belastung sein. Aber für viele ist es auch eine große Freude in ihrem Leben. Und das verweigern wir vielen Männern im Moment. Das ist etwas, was bei der Veröffentlichung meines Buches in Dänemark wirklich erstaunlich war: Viele Männer haben es genutzt, um darüber nachzudenken, was ihnen entgeht.