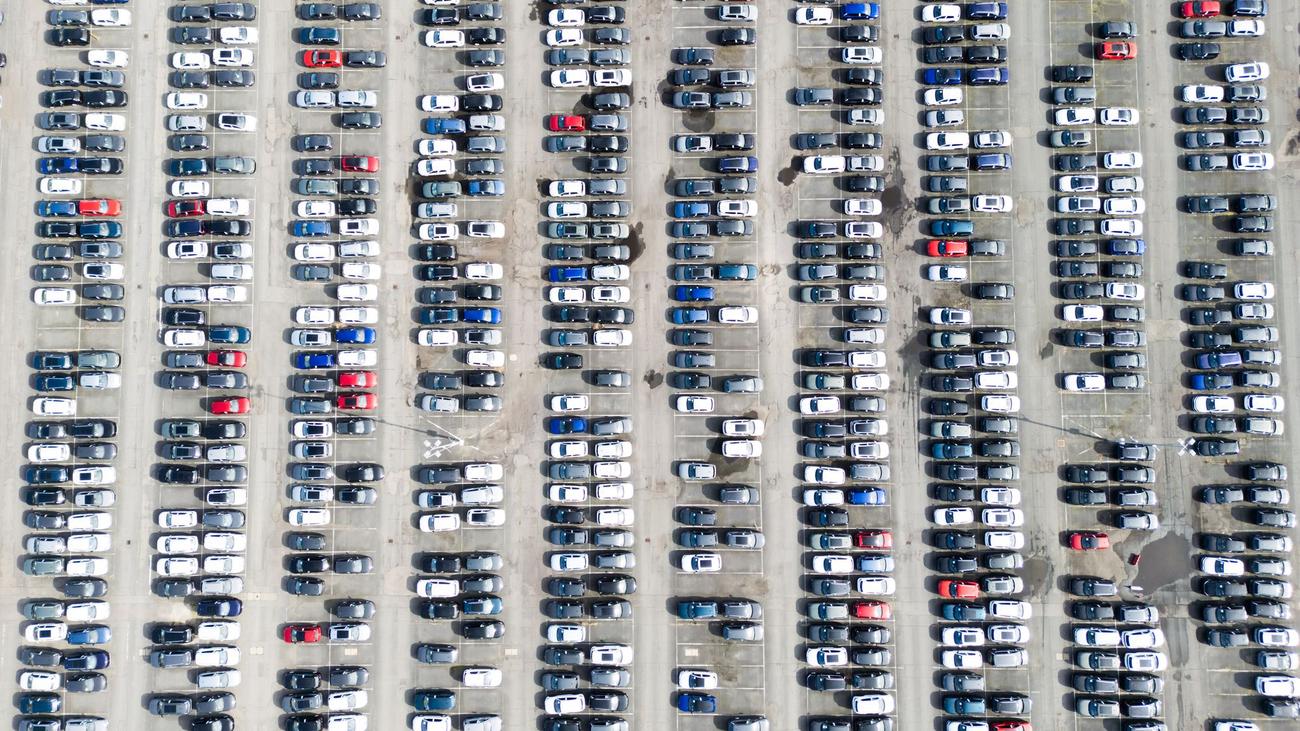Die Finanzen der Kirche: Der neue Papst muss sparen

Kirche in finanzieller Schieflage – Der neue Papst muss sparen Der Vatikan hat ein riesiges Vermögen, doch er lebt seit langem über seine Verhältnisse und zehrt von der Substanz. Papst Franziskus’ Nachfolger sollte auch ein guter Manager sein. Armin Müller Der unbezahlbare Schatz des Vatikans: Der Petersdom in Rom ist eines der grössten und bedeutendsten Kirchengebäude der Welt. Foto: Gabriel Bouys (AFP) Jetzt abonnieren und von der Vorlesefunktion profitieren. Abo abschliessenLogin BotTalk Integrität und Glaubwürdigkeit, diplomatisches Geschick, Führungsstärke, Sprachkenntnisse, Demut, ein tiefes Verständnis des katholischen Glaubens: Das müssen Päpste für ihr Amt mitbringen. Diesmal kommt noch eine weitere Anforderung hinzu: Der neue Papst sollte zwingend über Managementfähigkeiten verfügen. Besonders Finanzkenntnisse wären von Vorteil. Denn der Heilige Stuhl, so heisst die «Regierung» der katholischen Kirche, lebt seit Jahren über seine Verhältnisse. Steigende Ausgaben, sinkende Spendeneinnahmen, hohe Defizite, Skandale und mangelnde Transparenz. Der letzte verfügbare Jahresbericht von 2023 weist einen Betriebsverlust von 83,5 Millionen Euro aus. Spenden der Gläubigen, Erträge von zwei Spitälern, die Einnahmen aus den vatikanischen Museen und die Verkäufe von Souvenirs, Briefmarken und Münzen reichen bei weitem nicht, um die hohen Ausgaben für Personal und zahlreiche karitative Aufgaben zu decken. Das Defizit beträgt seit 2021 7 bis 8 Prozent der Einnahmen. Auch die Finanzerträge – vor allem aus Immobilien und Kapitalanlagen – reichten in den letzten Jahren nie, um die Betriebsverluste zu kompensieren. Der Heilige Stuhl befindet sich finanziell in struktureller Schieflage und zehrt von der Substanz. «Ein Defizit bedeutet, dass ein Teil des Vermögens vernichtet wird, und das schränkt die Zukunft ein. Und deshalb müssen wir den Trend umkehren», schrieb Papst Franziskus in einem Brief an die Mitarbeiter seines Wirtschaftssekretariats. Alle seien mitverantwortlich, die notwendigen Ressourcen zu garantieren, «damit diejenigen, die nach uns kommen, den Weg fortsetzen können». Dramatischer Sparappel von Papst Franziskus Im September letzten Jahres wandte sich der Papst deswegen mit einem dramatischen Sparappell an seine Kardinäle. Man habe erkannt, «dass die wirtschaftlichen Ressourcen zur Erfüllung des Auftrags begrenzt sind und dass man streng und seriös mit ihnen umgehen muss, damit die Mühen derer, die zum Vermögen des Heiligen Stuhls beigetragen haben, nicht vergeudet werden». Die Kardinäle müssten mit gutem Beispiel vorangehen. Um die Effizienz zu steigern, solle der Lohn künftig stärker an die Leistungen der einzelnen Mitarbeitenden gekoppelt werden, kündigte der Kapitalismuskritiker Franziskus an. Finanziell in Schieflage befindet sich auch der Pensionsfonds für die Mitarbeitenden. Die Erfüllung der Rentenverpflichtungen sei nicht gesichert, warnte der Papst im November und ernannte einen Kardinal mit Betriebswirtschaftsstudium zum Krisenmanager des Fonds. Die vom Papst angeordneten Sparmassnahmen – Beschränkungen bei der Einstellung von Personal und der Vergabe von Aufträgen – führten zu Beschwerden der Angestellten. Die Vereinigung der Laienmitarbeiter im Vatikan beklagt, dass Überstunden nicht bezahlt wurden, dass es seit Jahren keine altersabhängigen Gehaltserhöhungen mehr gab und dass sie wegen des Einstellungsstopps mehr arbeiten müssten. Franziskus hat in seiner Amtszeit weitreichende Wirtschaftsreformen angestossen und teilweise auch umgesetzt, besonders was Aufsicht, Transparenz und professionelle Finanzpraktiken angeht – gegen starken Widerstand aus der vatikanischen Bürokratie. Er war noch nicht einmal ein Jahr im Amt, als er das Sekretariat für Wirtschaft gründete. Es übernahm die zentrale Aufsicht über die Finanzen des Vatikans mit weitreichenden Befugnissen zur Prüfung der zahlreichen Verwaltungsabteilungen, die vorher weitgehend eigenmächtig wirken und über ihre Spendengelder verfügen konnten. Aufräumen in der Skandalbank Die skandalgeschüttelte Vatikanbank IOR musste 2013 erstmals eine Jahresrechnung veröffentlichen. Im Rahmen der Aufräumarbeiten wurden Tausende Konten von reichen Familien und Politikern Italiens geschlossen. Die Bank fungiert nun in erster Linie als Zahlungsdienstleister und Finanzberater für katholische Wohltätigkeitsorganisationen, religiöse Orden und Angestellte der Vatikanstadt – der Spekulation mit Immobilien und Finanzanlagen wurde ein Ende gesetzt. Die Verwaltung der Immobilien, Kunstgegenstände und Finanzanlagen wurde grösstenteils der APSA übertragen, einer Art Zentralbank und Staatsfonds des Vatikans. Dazu gehören rund 5500 Immobilien, davon rund 4250 in Italien und 344 in der Schweiz. Es handelt sich um Wohnungen, Kirchen, Klöster, Bürogebäude und Land. Um das Gesamtvermögen des Heiligen Stuhls ranken sich Mythen. Aber wie sollte man den Petersdom, die Sixtinische Kapelle oder die riesige Kunstsammlung bewerten? Sie sind unbezahlbar wertvoll, aber alles andere als profitabel. Die Kirchen zum Beispiel können nicht verkauft und nicht beliehen werden, kosten aber Millionen für Instandhaltung und Restaurierung. Unbezahlbar: Ein Blick in die Sixtinische Kapelle in der Vatikanstadt. Foto: Andreas Solaro (AFP) Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögenswerte sagen wenig aus, es gibt enorme stille Reserven. Viele Immobilien sind zum symbolischen Preis von einem Euro bewertet. Ihre Bewirtschaftung leidet unter Vetternwirtschaft und Ineffizienz. 70 Prozent der Gebäude werden gratis zur Verfügung gestellt, 10 Prozent zu subventionierten Mieten. Nur jedes fünfte wird zu marktüblichen Preisen vermietet. 2023 wurde das kostenlose Wohnen für Mitarbeitende gestrichen, auch hochgestellte Geistliche sollten für ihre Wohnungen in Rom ortsübliche Mieten zahlen. Ob es auch durchgesetzt wurde, wird von Kritikern bezweifelt. Franziskus setzte nicht nur bei den Kosten, sondern auch auf der Einnahmenseite an. Im letzten Jahr wurden die Eintrittspreise in die Museen um 18 Prozent auf 20 Euro erhöht. Bevor er im Februar wegen Lungenentzündung ins Spital musste, erliess er ein Dekret zur Schaffung einer Kommission für Spenden an den Heiligen Stuhl. Mit rund 45 Prozent bilden Spenden den grössten Einnahmenblock. Aber sie sinken tendenziell. Die katholische Kirche wächst in den armen Ländern, aber in den reichen Ländern häufen sich die Kirchenaustritte. Der Peterspfennig, die grösste weltweite Kollekte für den Heiligen Stuhl, brachte 2016 bis 2019 im Schnitt 55 Millionen Euro pro Jahr, seither nur noch 46 Millionen. Die neue Kommission soll den Abwärtstrend bei den Spendeneinnahmen umkehren. Franziskus hat mit seinen Wirtschaftsreformen einiges erreicht, die Effizienz etwas erhöht, Misswirtschaft und Korruption eingedämmt. Aber die Reformen sind längst nicht abgeschlossen, das strukturelle Defizit nicht beseitigt, der Pensionsfond weiterhin in Schieflage, die Transparenz gemessen an internationalen Standards ungenügend, die internen Widerstände nicht gebrochen. «Was getan wurde, sollte uns nicht zu der Annahme verleiten, dass der Weg der Wirtschaftsreform abgeschlossen ist. Im Gegenteil, er hat gerade erst begonnen», schrieb Papst Franziskus in einem Brief an die Mitarbeiter des Wirtschaftssekretariats. Der Satz liest sich wie ein Auftrag an seinen Nachfolger. Und er macht deutlich: Der neue Papst sollte nicht nur ein hervorragender Seelsorger, sondern auch ein sehr guter Manager sein. Newsletter Wirtschaft heute Erhalten Sie die wichtigsten News aus der Wirtschaft sowie die besten Hintergründe und Analysen. Weitere Newsletter Einloggen Armin Müller ist Autor im Wirtschaftsressort. Er schreibt hauptsächlich über wirtschaftliche und wirtschaftspolitische Themen. Mehr Infos @Armin_Muller Fehler gefunden?Jetzt melden.