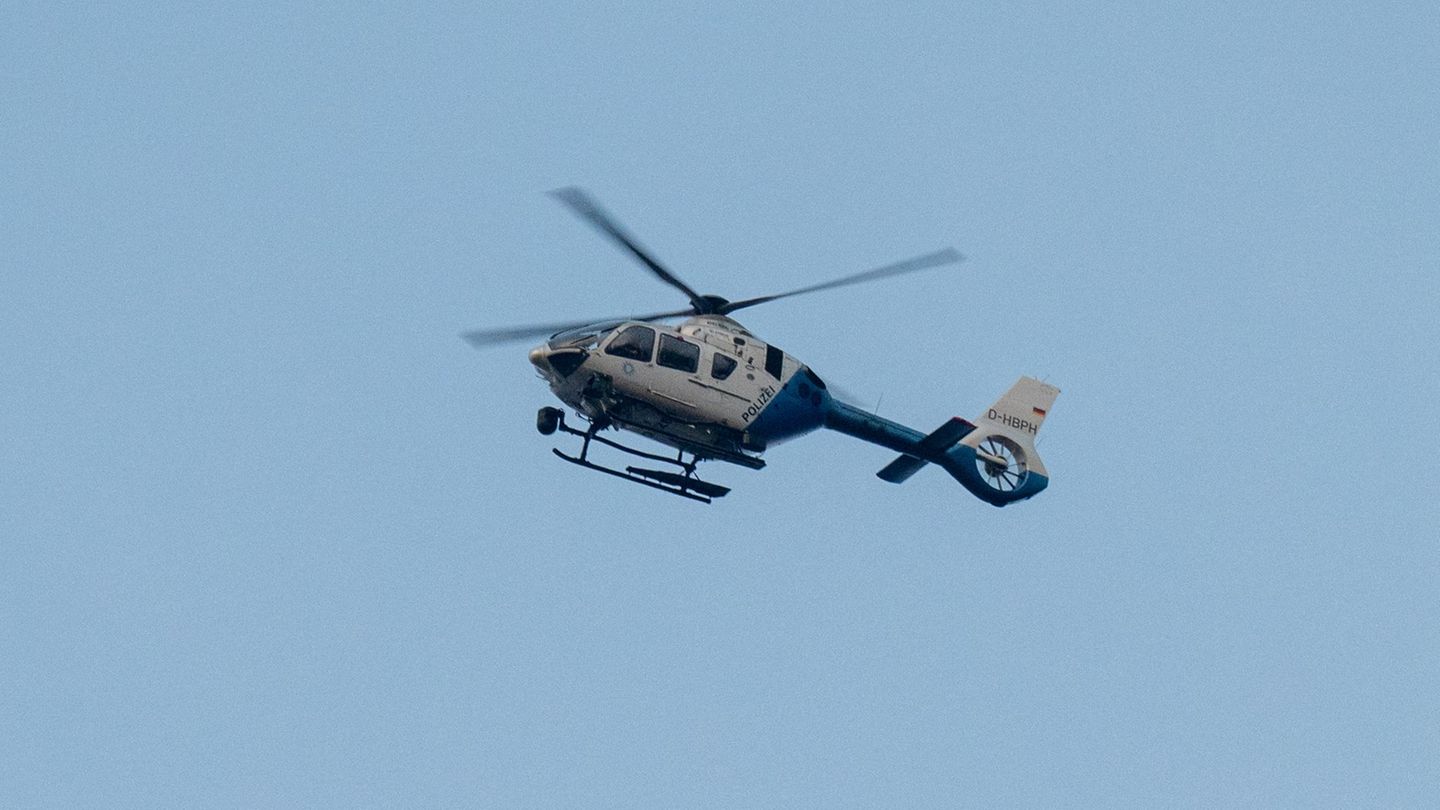Frühkindliche Bildung: Eine Kita-Pflicht sollte kein Tabu mehr sein
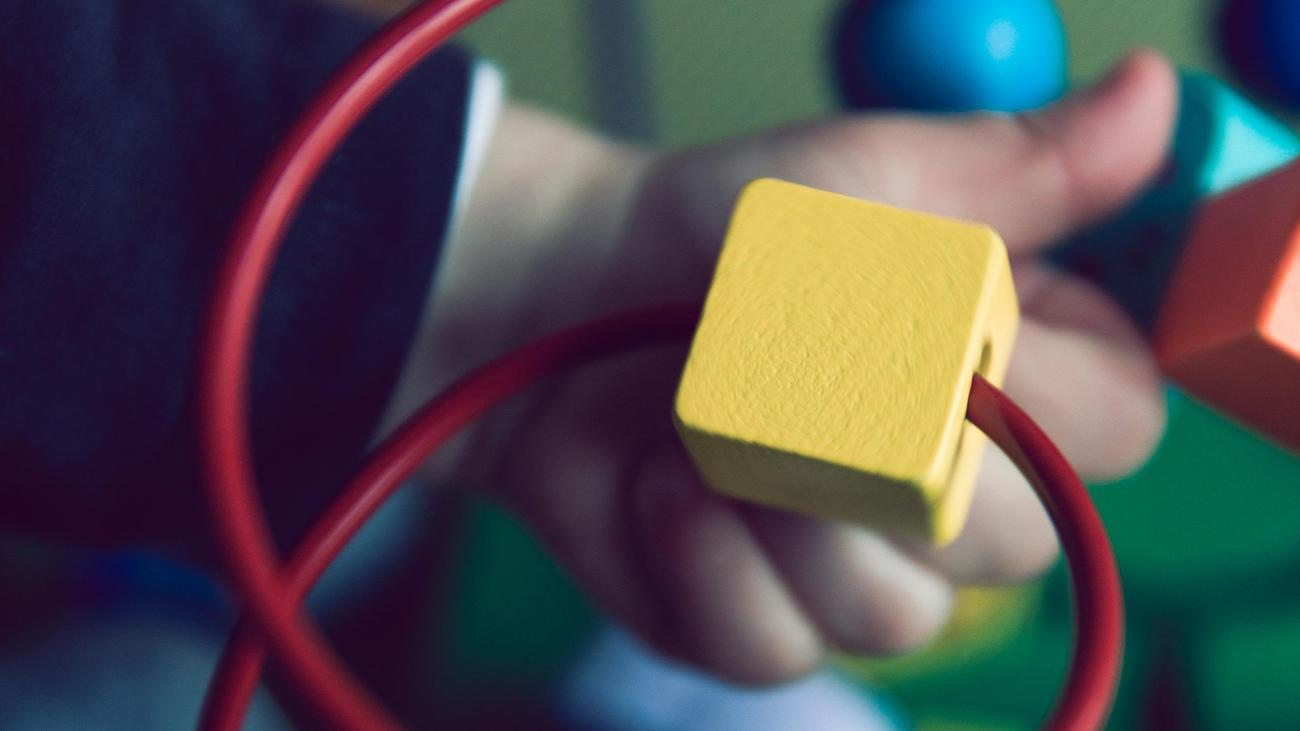
Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 Eine Kita-Pflicht sollte kein Tabu mehr sein Seite 2 Wir brauchen dringend eine Kehrtwende In kaum einem Industrieland sind die Bildungschancen so ungleich verteilt wie in Deutschland. Trotz eines größtenteils öffentlichen Bildungs- und Betreuungssystems hängen die Bildungschancen in Deutschland stärker von der sozialen Herkunft – insbesondere der Bildung und dem Einkommen der Eltern – ab als in vielen anderen Ländern. Eine neue Studie zeigt, wie stark der Schlüssel für diese Ungleichheit in der frühkindlichen Bildung liegt. Deutschland hat ein doppeltes Problem mit seinem Bildungssystem: Zum einen nehmen Kompetenzen ab; zum anderen ist die Ungleichheit im Bildungsniveau bei Kindern und Jugendlichen groß und hat sich in den vergangenen 20 Jahren auch kaum verändert – so die Pisa-Studien der OECD. Das Niveau bei den Fähigkeiten in Bezug auf Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften nimmt seit gut zehn Jahren stetig weiter ab. Eltern stehen unter großem Druck Das deutsche Bildungssystem steckt fest. Es ist unfähig, sich mit der Zeit und den Veränderungen in Arbeitsmarkt, Medien und Gesellschaft weiterzuentwickeln und den Anforderungen gerecht zu werden. Die Beharrungskräfte bei Politik, Eltern und den Bildungseinrichtungen sowie die häufig mangelnde Transparenz und Rechenschaft machen Reformen allzu häufig unmöglich. Einer der Hauptgründe für die zunehmende Ungleichheit der Bildungschancen liegt in den Veränderungen am Arbeitsmarkt und im Familienmodell, vor allem in Westdeutschland. Elternpaare stehen unter großem Druck, dass beide berufstätig sind. Befragungen zeigen, dass beide Eltern sich dies wünschen und gleichermaßen hohen Wert auf eine berufliche Karriere legen. Im internationalen Vergleich ist dieser Wunsch nicht ungewöhnlich. Deutschland unterscheidet sich jedoch von den meisten anderen westlichen Demokratien dadurch, dass das Bildungs- und Betreuungssystem in Deutschland sehr viel Verantwortung an die Eltern übergibt. Obwohl seit mehr als zehn Jahren ein rechtlicher Anspruch auf einen Kitaplatz besteht, haben ein Fünftel der Familien mit ein- bis zweijährigen Kindern keinen Platz. Auch bei drei- bis fünfjährigen Kindern und Grundschulkindern ist der Bedarf an Betreuungsplätzen nicht vollständig gedeckt. Auch an der Qualität mangelt es häufig, sodass die Eltern schulische Defizite kompensieren müssen. Eltern mit guter Bildung und starkem Einkommen können dies meist sehr viel besser. So haben knapp die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen im Alter von 15 Jahren bereits Nachhilfeunterricht bekommen. Diese Hälfte lebt jedoch größtenteils in Haushalten mit hohen Einkommen, in denen die Eltern sich die Kosten leisten können. Der Schaden ist enorm Zum anderen ist die Ungleichheit bei Bildungschancen und Abschlüssen in Deutschland größer als in den meisten anderen Industrieländern. Etliche Studien haben gezeigt, dass Abschlüsse und Bildungserfolge ungewöhnlich stark von der sozialen Herkunft, also insbesondere von Einkommen und Bildung der Eltern, abhängen. 75 Prozent der Kinder, deren Eltern Abitur haben, besuchen ein Gymnasium, jedoch nur 28 Prozent der Kinder, deren Eltern kein Abitur haben. Fast die Hälfte des Einkommens im Berufsleben wird durch den Familienhintergrund erklärt. Newsletter Fratzschers Verteilungsfragen Die Soziale Marktwirtschaft funktioniert nicht mehr: Jede Woche schreibt Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, über die zunehmende Ungleichheit. Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis. Vielen Dank! Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie das Newsletter-Abonnement. Diese E-Mail-Adresse ist bereits registriert. Bitte geben Sie auf der folgenden Seite Ihr Passwort ein. Falls Sie nicht weitergeleitet werden, klicken Sie bitte hier . Der Schaden durch die hohe Ungleichheit der Bildungschancen für Wirtschaft und Gesellschaft ist enorm. Knapp 50.000 junge Menschen gehen jedes Jahr ohne Schulabschluss von der Schule – eine hohe Zahl. Der Lebensweg von vielen von ihnen ist somit vorgezeichnet. Die Arbeitslosenquote derjenigen ohne Berufsabschluss liegt bei mehr als 20 Prozent, die von denen ohne Schulabschluss liegt noch deutlich darüber. Prekäre Beschäftigung und Arbeitslosigkeit führen zu einer schlechteren Gesundheit, weniger Zufriedenheit und Glück sowie einer geringeren Autonomie. Allzu oft führt dies in einen Teufelskreis, und es heißt: "Armut vererbt sich". Die kommenden Generationen haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, selbst mit wenig Bildung und Einkommen ihrer Chancen beraubt zu werden und in Armut zu landen. Und auch für den Sozialstaat sind die dadurch verursachten Kosten enorm. Die frühkindliche Bildung ist der Schlüssel Umgekehrt ist der potenzielle Nutzen eines besseren Bildungssystems, das vor allem mehr Chancengleichheit schafft, groß. Intelligenz sowie kognitive und nicht kognitive Fähigkeiten sind kaum genetisch bedingt, sondern vor allem durch das Umfeld und das eigene Elternhaus geprägt. Die geringe Mobilität bei Bildungschancen bedeutet, dass viele junge Menschen ihre Fähigkeiten und Talente nicht voll entwickeln und nutzen können. Dadurch entgeht auch der Wirtschaft ein riesiges Potenzial an Fachkräften, die in Zeiten des demografischen Schrumpfens dringender denn je benötigt werden. Mehr und besser qualifizierte Fachkräfte bedeuten Innovation und Wachstum, bessere Arbeitsplätze und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft. Eine neue Studie des DIW Berlin zeigt, dass der Schlüssel in der frühkindlichen Bildung liegt. Die Analysen ergeben, dass die soziale Herkunft in Deutschland einen beträchtlichen Teil der Ungleichheit im Bildungserfolg vor allem in den ersten Lebensjahren erklärt. So werden 20 Prozent der Sprach- und 14 Prozent der Mathematikkompetenzen von Siebenjährigen in Deutschland allein durch Bildung und Einkommen der Eltern erklärt. Dies ist deutlich mehr als in anderen Industrieländern. Besonders erschreckend ist der Vergleich mit den USA: Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und sprachlichen Kompetenzen ist in Deutschland noch stärker als in den USA (in Deutschland gehen 20 Prozent der Unterschiede auf die soziale Herkunft zurück, in den USA 12 Prozent). Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Mathematikkompetenzen ist in Deutschland genauso stark wie in den USA (jeweils 14 Prozent). Die Einkommensungleichheit ist in den USA deutlich größer als in Deutschland, ein großer Teil des Bildungssystems in den USA ist privat organisiert, und auch bei öffentlichen Schulen sind die Einkommen der Eltern durch Abgaben und direkte finanzielle Beiträge wichtig. Und trotzdem spielt die soziale Herkunft in Deutschland eine noch größere Rolle als in den USA.